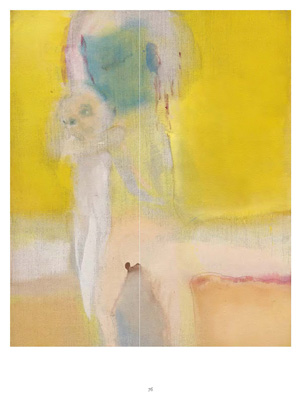Mein persönliches 68
Ich erinnere mich, als wäre es gestern gewesen. Karfreitag 1968. Ich war, um zu volontieren, zurück gegangen nach Deutschland und besuchte nun meinen Freund in Paris. Am Abend zuvor hatte uns die bedrückende Nachricht erreicht: Rudi Dutschke ist angeschossen worden und liegt lebensgefährlich verletzt im Krankenhaus. Dutschke, der bekannteste unter den APO-Aktivisten (APO = Außerparlamentarische Opposition) war einer der Leader des SDS, des Sozialistischen Studentenbundes. Und vorausgegangen war eine wahre Hetzkampagne gewisser Medien, vor allem der Springer-Blätter, gegen die APO, allen voran gegen Dutschke. Sein Gesicht war millionenfach steckbriefartig veröffentlicht worden.
Ich weiß nicht mehr, woher wir die Information hatten, oder ob wir vielleicht einfach intuitiv gehandelt haben. Wir gingen jedenfalls zur deutschen Botschaft, Avenue Matingnon. Dort hatte sich bereits eine Hundertschaft Menschen versammelt, überwiegend Franzosen. Ein paar improvisierte Transparente, Proteststimmung. Langsam begriffen wir, dass es einen Anführer gab: ein kleiner untersetzter Rothaariger. Er umkreiste uns wie ein Schäferhund seine Herde, trieb uns an und gab die Parole aus: „Tous à la Fontaine Saint Michel!“ – Alle zum Saint-Michel-Brunnen. Wir folgten, überquerten die Seine, vorbei am Parlament, Richtung Quartier Latin.
Einen Monat später sollte der kleine Rothaarige berühmt sein: als Anführer auf den Barrikaden des Mai 68 in Paris. Daniel Cohn-Bendit, Sohn einer deutsch-jüdischen Mutter und eines französischen Vaters, aufgewachsen in Frankreich wie Deutschland, deutsche Staatsangehörigkeit – und im Sommer 1968 als „Deutscher Jude“ von de Gaulle aus Frankreich ausgewiesen. Die Kameraden von „Daniel le rouge“ protestierten: „Nous sommes tous des juifs allemands!“ – Wir sind alle deutsche Juden.

Was ich nicht mitbekommen hatte, da ich keine Studentin war, sondern berufstätig, war, dass es seit dem Tod von Benno Ohnesorg am 2. Juni 1967, einen regen Austausch gegeben hatte zwischen linken Studenten aus Berlin mit denen in Paris, angeregt nicht zuletzt von Cohn-Bendit, der zu der Zeit an der „roten Fakultät“ in dem Pariser Vorort Nanterre studierte. Der Student Ohnesorg war bei einer Anti-Schah-Demonstration in Berlin von einem Polizisten erschossen worden (Da konnte noch niemand ahnen, dass der Schah von Persien zwar ein Übel, aber das kleinere Übel war im Vergleich zu dem Mullah-Regime Khomeinis, der den Schah 1979 verjagen würde).
Auch ich verfolgte mit heißem Herzen die zunehmenden politischen Proteste, von zu Hause war ich schließlich Kritik an den Verhältnissen gewohnt: gegen die Alt-Nazis, gegen den Vietnam-Krieg der Amerikaner, gegen die geplanten Notstandsgesetze in der Bundesrepublik. Das unterschied mich wohl fundamental von der Mehrheit der deutschen 68er und auch späteren Feministinnen: Innerfamiliär hatte ich weder gegen autoritäre Strukturen noch gegen Alt-Nazi-Lasten zu kämpfen – im Gegenteil, ich war von Kindesbeinen an aufgeklärt und aufgerüttelt worden. In meiner Familie war man schon zu Nazizeiten gegen die Nazis gewesen – und hatte auch entsprechend gehandelt.
Im Mai 68 war ich dann längst wieder auf Posten bei den Düsseldorfer Nachrichten, die politisch den Ruf der „Generalanzeigerpresse“ hatten, das heißt, scheinbar neutral waren, aber doch eher gut konservativ. Und das Dorf an der Düssel war auch nicht gerade eine Hochburg der Studentenbewegung. Die einzigen, die da Action machten, waren die KunststudentInnen unter der Ägide von Joseph Beuys. An eine Aktion erinnere ich mich mit besonderem Vergnügen: Wie Beuys eine Immatrikulationsfeier sprengte mit einer donnernden Tonband-Dauerschleife: „Betreten des Rasens verboten!“
In diesem Mai 68 gab es selbst in Düsseldorf eine ordentlich angemeldete Demonstration gegen die Notstandsgesetze, bei der auch ich mitmarschierte. Die zweite Demo in meinem Leben. Bei der Schlusskundgebung griff ich zum ersten Mal zum Mikro und rief auf zur Solidarität mit den Pariser Barrikaden-Stürmern und Protestkundgebung vor dem französischen Konsulat. Was mir einen Pfiff und den Ruf „Hey Bonnie“ eintrug. Es war die Zeit von Bonnie & Clyde, und ich trug standesgemäß den vollen Bonnie-Look, Baskenmütze inklusive. Ich bin nie mehr auffallend modisch auf eine Demo gegangen.
Geschrieben hat in den Düsseldorfer Nachrichten dann ein Mit-Volontär über dieses relativ harmlose Ereignis. In seinem Bericht wurde ein Aufstand „geifernder Bärtiger“ daraus (die ich nirgendwo gesehen hatte). Ich stellte den Kollegen zur Rede, der stellte sich dumm. Er hatte zweifellos ohne Aufforderung so tendenziös geschrieben. Ich begann zu begreifen, dass eines der Probleme der Medien der Opportunismus gewisser Journalisten und ihr vorauseilender Gehorsam ist.
Im Jahr darauf war ich dann endlich in einer Hochburg der Studentenrevolte gelandet: in der Pardon-Redaktion in Frankfurt. Pardon galt, neben konkret, als eines der beiden APO-Organe, und war eine satirische Zeitschrift (und Vorläuferin von Titanic) mit real-journalistischen Reportagen. Dafür war nun Reporterin Schwarzer zuständig, als Nachfolgerin von Günter Wallraff, der das weite gesucht hatte.

An einem meiner ersten Tage in der Redaktion wurde ich erstmal nach meiner Meinung zur „Frankfurter Schule“ befragt. Dass die junge Journalistin, die gerade aus Düsseldorf und Paris kam, mit dieser von Adorno und Horkheimer in Frankfurt begründeten Denkschule zunächst nicht so viel anfangen konnte, hob nicht gerade ihr Renomee… Genauso wenig wie die Tatsache, dass ich in den sechs Monaten, die ich bei Pardon durchgehalten habe, mit keinem von den Jungs im Bett gewesen war. Was mir zum Abschied auf einer Redaktionsfete den angetrunkenen Kommentar des Kollegen Peter Knorr eintrug: „Eigentlich bist du ja ganz nett. Aber schade, dass du frigide bist.“ Ich antwortete nicht. Mir hatte es längst die Sprache verschlagen.
Es wäre jedoch falsch, nun zu glauben, dass wir linken JournalistInnen uns duzten. Nein, wir siezten uns selbstverständlich, das war damals so. Und als ich bei einer meiner „Rollenreportagen“ – also Reportagen, wo ich als Journalistin undercover eine bestimmte Rolle spielte – im Club Méditerranée im marokkanischen Agadir zusammen mit Robert Gernhardt (als rasender Fotoreporter) auf der Suche nach der Sünde war, und wir im Zuge unserer enttäuschend keuschen Recherche dann doch irgendwann zum kühnen Du übergingen – da beschlossen wir auf dem Rückflug, uns in Frankfurt wieder zu siezen. Damit niemand auf falsche Gedanken komme, schon gar nicht Gernhardts Frau Almut.
Eine meiner ersten Rollenreportagen für Pardon machte ich am Fließband bei VDO. Das waren harte Wochen, nicht zuletzt, weil der Vorarbeiter mir nachstellte. Abends schlief ich hundemüde vor dem Fernseher ein oder fiel gleich ins Bett. Am Wochenende war dann Kino oder der Republikanische Club angesagt, Treffpunkt der 68er. Und wen sehe ich da wieder? Meinen kleinen Rothaarigen! Der zieht, umringt von langbeinigen Langhaarigen, im Club Voltaire ein. Inzwischen war Cohn-Bendit zum Medienstar avanciert und hatte in Italien die Hauptrolle in einem Western gespielt.
Irgendwie kam ich mir fremd vor in diesem Republikanischen Club. Ich wusste aber noch nicht so recht, warum. Fremd fühlte ich mich auch in der Pardon-Redaktion, und das nicht nur, weil ich der erste und letzte weibliche Journalist in dieser Redaktion war (alle anderen Frauen waren Sekretärinnen oder Assistentinnen). Auch wegen der Cover. Wenn einmal im Monat die Titelbilder ausgesucht wurden, projezierte man die von der Redaktion in Auftrag gegebenen Fotos via Dia an die Wand. Meist waren das Fotos aus einer „Landkommune“, in der hübsche Mädchen oben ohne ihren Busen in die Kamera hielten und wg. Revolution in der Hand eine rote Fahne schwenkten. „Nein, das nicht. Das vorher war besser, da konnte man die Brustwarze ganz sehen“, kommentierte dann der durchaus charmante Verleger und Chefredakteur Hans Nickel. Ich schwieg. Was hätte ich dazu sagen sollen? Worte hatten wir Frauen damals noch nicht für unser Unbehagen. Die kamen erst mit der Frauenbewegung.
Fremd fühlte ich mich auch in der Studentinnen-WG in Bockenheim, wo ich nach dem legendären „Tomatenwurf“ am 13. September 1968 über den „Weiberrat“ recherchierte (die Pardon-Redaktion versprach sich davon vermutlich noch mehr barbusige Kommunardinnen). Immerhin: Auf dem Tisch in der WG-Küche lag, neben Werken von Marx und Reich, „Das andere Geschlecht“ (das hatte ich inzwischen auch gelesen). Aber die Sprache dieser Studentinnen! Vom „Hauptwiderspruch“ war die Rede (dem Klassenkampf) und vom „Nebenwiderspruch“ (der Frauenfrage); von „Proletariat“, „Imperialismus“ und „Kapitalschulungen“.
Ich habe dann letztendlich nie über den Frankfurter „Weiberrat“ geschrieben. Wohl, weil ich sein Verhältnis von Theorie und Leben eher kritisch sah, das aber aus Solidarität nicht schreiben wollte. Und auch, weil ich dann ziemlich bald zurück ging nach Paris, dieses Mal jedoch nicht als Sprachstudentin, wie bei meinem ersten Aufenthalt in Paris, sondern jetzt als freie Korrespondentin.
Doch trotz meines Fremdelns mit den 68ern waren ihre Themen die meinen. Ich spezialisierte mich in den sozialen, kulturellen und politischen Folgen von 68 und berichtete und schrieb für Rundfunk und Printmedien über wilde Streiks, soziale Missstände in den Vorstädten oder Foucaults neue Theorien.
Bald wusste ich so gut bescheid über Arbeitskämpfe und Sozialrevolten, über emanzipierte Mode (wie die von Courège und Yves Saint Laurent) und avantgardistisches Theater, über Maoisten und Trotzkisten, dass sowohl der französische Geheimdienst wie auch die DDR-Stasi versuchten, mich anzuheuern.
Bei der Stasi ging das so: Ein angeblicher Kollege namens Pietsch aus Leipzig bat die Kollegin um ein Treffen in Paris. Warum nicht? Doch dann hieß es plötzlich, das Treffen solle in Straßburg stattfinden, und ich sollte für Geld Informationen liefern. Da habe ich dann geschaltet und den Kontakt abgebrochen. Doch wie oft ist eigentlich der Kontakt von potenziellen Informanten nicht abgebrochen worden?
Inzwischen lag die Sache mit den Frauen in der Luft. Aus Amerika hörten wir von der „Women’s lib“, erste feministische Texte tauchten auf, und in Holland machten die Aktionen der „Dollen Minnas“ Furore. Ich erinnere mich noch gut, wie ich im Frühling 1970 auf dem Campus der Fakultät Vincennes, wo ich nebenher studierte, träumerisch zu ein paar Kommilitoninnen sagte: „Sowas müssten wir hier auch haben: So eine Frauenbewegung…“
Wenige Wochen später war es so weit. Zum Jahrestag des Sieges über Hitlerdeutschland legte ein knappes Dutzend Frauen neben den traditionellen Kranz für „den unbekannten Soldaten“ einen Kranz für „die unbekannte Frau des unbekannten Soldaten“ unter den Arc de Triumph – sie wurden prompt erstmal mit auf die Polizeiwache genommen. Da waren sie also, die ersten französischen Feministinnen.
Ein paar Wochen später hatte ich sie aufgespürt. Im September 1970 waren wir noch ein, zwei Dutzend, wenige Monate später waren wir schon ein paar hundert. Die Mischung war bunt. Unser Alter ging von 16 bis 60; wir waren Französinnen, Nordafrikanerinnen, Kubanerinnen oder Deutsche; Schriftstellerinnen, Studentinnen und eine Striptease-Tänzerin aus dem Crazy Horse. Wir waren durch und durch anarchisch, sehr kreativ und gaben bald den Ton an. Schon Ende 1970 war le MLF, wie wir nun hießen, das Mouvement de liberation des femmes, so angesagt, dass Jean Luc Godard in seinem Werbefilm für DIM-Strumpfhosen eine Kette von (Pseudo)Emanzen am Horizont aufmarschieren ließ.
Wir Pionierinnen des MLF kamen teils aus der 68er-Bewegung, frustriert vom Machismus der eigenen Genossen; teils waren wir quasi geborene Feministinnen und engagierten uns nun erstmals aktiv in einer politischen Bewegung. Auf jeden Fall waren wir antihierarchisch, anti-Kapitalismus, anti-Macker. Und ich lebte von nun an eine Art Doppelleben: als linke Journalistin für Deutschland – und als aktive Feministin in Frankreich.
Eines Tages meldete sich der französische Geheimdienst bei mir und lud die Korrespondentin mit der alljährlich zu erneuernden Aufenthaltsgenehmigung vor. Die beiden Herren (zwei Korsen, ganz wie im französischen Klischee, von denen der eine tatsächlich Piccoli hieß) saßen zwischen Bergen von linken und feministischen Postillen und Flugblättern und redeten nicht lange drumrum. Sie gaben zu verstehen, dass sie mein Leben seit geraumer Zeit im Detail kannten und nun von mir regelmäßige Rapports über die Frauenbewegung und die linke Szene erwarteten – so ich denn meine Aufenthaltsgenehmigung verlängert haben wolle.
Ich war empört. Kaum raus, steuerte ich gleich gegenüber noch auf der Cité die nächste Telefonzelle an und wählte die Nummer von niemand Geringerem als Maître Leclerc, dem damaligen Staranwalt der Linken. Der bestärkte mich in meiner Absicht, in die Offensive zu gehen. Ich hing also den Erpressungsversuch an die große Glocke; es erschienen Berichte im Express, Nouvel Observateur und Le Monde – und ich hörte nie mehr von Monsieur Piccoli und seinem Kollegen.
Doch: Ein Kollege bei Le Monde wunderte sich über meine Empörung. Ja, wissen Sie denn nicht, dass die Mehrheit Ihrer ausländischen Kollegen hier mit dem Geheimdienst kooperiert?, fragte er. Das raubte mir ein weiteres Stück Illusion über meinen Berufsstand – und ich stellte mir noch mehr Fragen nach der Verquickung der 68er mit ihren Gegnern.
Nun mache ich einen Sprung, denn was jetzt alles folgte, ist eine andere Geschichte. Ich lande wieder im Mai in Deutschland. Diesmal im Mai 1971. Wir Aktivistinnen des MLF hatten am 5. April im „Nouvel Observateur“ das „Manifest der 324“ veröffentlicht mit dem provokanten Bekenntnis: „Ich habe abgetrieben und fordere das Recht für jede Frau dazu“. Das schlug ein wie eine Bombe. Über die Aktion wurde international berichtet.
Kurz darauf rief mich mein Kollege Jean Moreau an, dessen Idee das französische Manifest gewesen war. Bei ihm habe so eine komische deutsche Zeitschrift namens Jasmin angerufen. Die wollten das Abtreibungsmanifest nun auch in Deutschland machen. Er habe aber den Eindruck, das Ganze sollte ein entpolitisierter Werbegag für die Zeitschrift werden. Ob ich denn da nicht etwas tun könne.
Ich überlegte nur kurz und rief dann den Ressortleiter Wilfried Maaß vom Stern an, für den ich ab und an schrieb. Ob er bereit sei, ein Manifest wie im Nouvel Observateur zu veröffentlichen, wenn ich ihm rund 300 Namen, darunter das Dutzend obligatorischer Prominente, brächte. Maaß zögerte nicht: „Ja, wenn Sie das schaffen…“ Er vermutete wohl eher, dass ich es nicht schaffe.

Ein paar Wochen später, am 6. Juni, erschien das „Manifest der 374“ im Stern. Doch es war leider keineswegs mit Hilfe der deutschen Frauenbewegung zustande gekommen, wie ich zunächst gehofft hatte. Denn die gab es einfach nicht. Noch im Frühling 1971 hatte selbst Brigitte geklagt: „Deutsche Frauen verbrennen keine Büstenhalter und Brautkleider, stürmen keine Schönheitskonkurrenzen und emanzipationsfeindlichen Redaktionen, fordern nicht die Abschaffung der Ehe und verfassen keine Manifeste zur Vernichtung der Männer. Es gibt keine Hexen, keine Schwestern der Lilith wie in Amerika, nicht einmal Dolle Minnas mit Witz wie in Holland, es gibt keine wütenden Pamphlete, keine kämpferische Zeitschrift. Es gibt keine Wut.“
Nun gab es sie, die Wut. Die Veröffentlichung des Abtreibungsmanifestes wurde zum Auslöser einer Lawine – und die zum Auslöser der Frauenbewegung.
Zuvor hatten nur noch rudimentäre Reste des Frauenprotestes innerhalb der Studentenbewegung existiert. Wie der „Weiberrat“ in Frankfurt, der noch immer „Kapitalschulungen“ machte und mich, die Botin aus Frankreich beschied, er mache bei dieser „kleinbürgerlichen“ und „reaktionären“ Abtreibungsaktion auf keinen Fall mit. Oder die „Roten Frauen“ in München, die auch schon mal Bakunin lesen durften, und bei der Diskussion über meinen aus Frankreich importierten Vorschlag noch am selben Abend in zwei Teile zerfielen: die einen machten weiter Kapitalschulungen, die anderen machten mit bei der „Aktion 218“ (gegen den § 218). Und der „Demokratische Frauenbund Westberlin“ (ein Ableger der SEW, der Berliner DKP), der zwar die Reihen stramm geschlossen hielt, die Aktion jedoch als geeignet befand zur „Agitation des Proletariats“ und mir eine Reihe Unterschriften mit strikten politischen Auflagen überließ.
Die einzigen, die die „Aktion 218“ als Gruppe mittrugen, war die „Frauenaktion 70“ in Frankfurt, ein Häuflein Frauen aus SPD und FDP, die schon in den Monaten zuvor tapfer und allein gegen den § 218 protestiert hatten.
Maximal ein Drittel der 374 Unterschriften dieser mutigen Frauen kam also durch organisierte Frauen zustande, zwei Drittel liefen über Mundpropaganda von Frau zu Frau: Freundinnen fragten Freundinnen, Nachbarinnen Nachbarinnen, Kolleginnen Kolleginnen. Sie alle waren Heldinnen. Sie alle wussten nicht, ob sie am Tag nach dem öffentlichen Bekenntnis verhaftet würden, ob ihnen die Stelle gekündigt würde oder ob ihre Nachbarn noch mit ihnen sprechen würden.
Am 6. Juni platzte die Bombe. Jetzt begannen die Frauen zu reden – und das nicht nur an der Uni oder in den WGs. Über sich. Ihre Verzweiflung. Ihre Sexualität. Ihre Träume. Der Rest war quasi ein Selbstläufer. Am 11. März 1972 reisten 450 Frauen aus 40 Gruppen zum ersten „Bundesfrauenkongress“ in der Jugendherberge von Frankfurt an. Es trafen aufeinander: geschulte Genossinnen und aufmüpfige Hausfrauen, interessierte Parteifrauen und versprengte Individuen, die schon immer die Emanzipation eigentlich selbstverständlich gefunden hatten.
Auch ich war aus Paris angereist. Zum einen, weil ich neugierig war, was denn nun geworden war aus dem Aufbruch der Frauen in Deutschland. Denn direkt nach dem Manifest im „Stern“ hatte ich zwar im Sommer 1971 das Buch „Frauen gegen den § 218“ geschrieben (das im Herbst in dem damaligen politischen Leitmedium, der edition suhrkamp, erschien). Ich hatte darin die Funktion des § 218 aufgezeigt und den Kampf der Frauen dagegen. Doch persönlichen Kontakt gehalten hatte ich von Paris aus nur zur „Aktion 218“ in München, den so undogmatischen und kämpferischen Frauen in Schwabing.
Und ich fuhr auch nach Frankfurt, um über die beginnende Frauenbewegung zu berichten, was sich dann u.a. in einem einstündigen Funk-Feature für den WDR niederschlug mit dem Titel: „Ich lass mir nichts mehr gefallen!“. Aber auch das ist wieder eine neue Geschichte.
Dieses Wochenende im November 1972 in Frankfurt jedenfalls endete mit dem folgenden offiziellen Statement, das den Beginn der Frauenbewegung in Deutschland markiert. Die Sprecherinnen erklärten: „Wir kamen überein, uns separat zu organisieren, solange Frauen in besonderer Weise und mehr unterdrückt sind als Männer. Wir rufen alle Frauen auf, sich für die Durchsetzung ihrer berechtigten Interessen selbst zu organisieren.“
In meinem im Herbst 1973 erschienenen zweiten Buch über „Frauenarbeit – Frauenbefreiung“ (oder die (Un)Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie man heute sagen würde) veröffentlichte ich dann im Anhang alle mir bekannten Adressen der „Frauenbefreiungs-Gruppen“ in der Bundesrepublik. Es waren zu diesem Zeitpunkt genau 43, von Baden-Baden bis Wiesbaden.
War die Zeit der Bevormundung durch die linken Männer also endlich vorbei? Nicht ganz. Die hatten noch im Herbst 1971 in einem Vorwort zu einer Neuausgabe von Klara Zetkin, selber eine deklariert antifeministische Sozialistin, im besten 68er-Jargon getönt: „Nicht von der bornierten und ständischen Interessenvertretung der bürgerlichen Frauenbewegung der Jahrhundertwende unterscheiden sich Initiativen westdeutscher Bildmagazine und ihrer Schauspielerklientel zur Abschaffen des § 218. Wer von Frauenbefreiung redet und den Zusammenhang im antikapitalistischen Kampf nicht einmal berührt, hätte besser geschwiegen.“
Nun, so ganz ließen die deutschen Frauen sich zwar von den Genossen das Wort nicht mehr verbieten. Doch sie taten sich weiterhin schwer, sehr schwer. Die Töchter der BDM-Mädchen und Hitler-Soldaten waren nicht zufällig später gestartet als ihre Schwestern in den Nachbarländern und das letztendlich auch nur dank einer Initialzündung von außen; sie waren die ganzen 70er Jahre über dem Rechtfertigungsdruck der Linken verhaftet geblieben und aus dem oft sektiererischen alternativen Kontext nicht wirklich rausgekommen. Auch waren diese Töchter und Söhne tief geprägt von den politischen Schemata ihrer Eltern. Es gab auch innerhalb der Linken in Deutschland zu der Zeit nur Schwarz oder Weiß, Richtig oder Falsch, Parole! Querdenken oder gar Ambivalenzen eingestehen war verpönt, ja verboten. Übrigens: In keinen Frauenzentren der Welt wurde so viel gestrickt und gestillt wie in den deutschen.
Es gibt eine These, die besagt, die fragmentarischen Organisationsstrukturen der 68erinnen innerhalb der Studentenbewegung wären die Ausgangsbasis gewesen zur raschen Entwicklung der Frauenbewegung. Diese These scheint mir richtig und falsch zugleich. Denn auf diesen Weiberräten und Roten Frauen konnten die Feministinnen nicht nur aufbauen, die waren gleichzeitig Blei an ihren Füßen. Sie tönten zehnmal „Klassenkampf“, bevor sie wagten, einmal vom Geschlechterkampf zu reden. Und sie verachteten die so genannten „bürgerlichen Frauen“ zutiefst. So manche motivierte Frau hat darum fluchtartig das Frauenzentrum wieder verlassen.
Und ich? Ich fuhr nach getaner Aktion im Mai 1971 zurück nach Paris, wo mein Leben, meine Frauenbewegung und meine Arbeit auf mich warteten und zog erst 1974 zurück nach Deutschland, kurzfristig nach Berlin. Als ich da zum ersten Mal ins Frauenzentrum Hornstraße ging, erlitt ich einen regelrechten Kulturschock. So konnte Frauenbewegung also auch aussehen: Meldung zur Geschäftsordnung, Kassenwartin, Schulung. Und noch immer gaben die Post-68erinnen den Ton an, die meisten inzwischen zu heimlichen Trotzkistinnen oder Maostinnen und Mitgliedern in K(ommunistischen)-Gruppen oder SEDlerinnen mutiert. Diese Strippenzieherinnen im Auftrag der Genossen betrachteten die Frauenzentren als „Durchlauferhitzer“ für eine „echte Politisierung“ und behandelten sie entsprechend. Die wahren Feministinnen hatten es schwer, in diesen meist straff geführten „Kollektiven“ ihre Stimme zu erheben.
Als ich dann, zusammen mit einer Handvoll Frauen, in gut französischer Tradition in der Berliner TU-Mensa am 11. Mai 1974 das erste deutsche Frauenfest organisierte, da taten diese Verwalterinnen der Frauenfrage wirklich alles, um das zu verhindern. Argument: „Die Basis versteht so was nicht.“ Es kamen über 2.000 Frauen zum „Rockfest im Rock“ – und tanzten bis morgens um vier.
Übrigens: Daran hat man diese pseudofeministischen Funktionärinnen der Frauenfrage immer gleich erkannt: an ihrer Stellvertreterpolitik. Sie sprachen grundsätzlich von „den Frauen“ – wir hingegen sprachen von „uns Frauen“. Endlich.