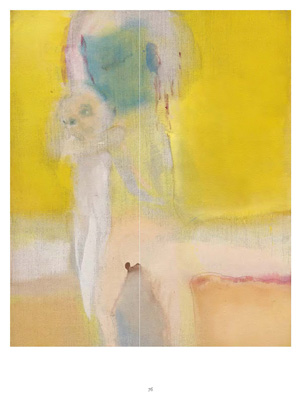"Ehrfurcht liegt mir nicht"
Um kurz vor zehn Uhr morgens an einem Freitag im November sitzt Alice Schwarzer allein am Tisch in der ziemlich vollen Lobby des Hotels »Vier Jahreszeiten« in München und wartet. Später wird sie erzählen, es sei ihr neuer Trick, zu früh dran zu sein. Dann stünde es, so sagt sie sinngemäß, immer erst mal Vorteil Schwarzer.
Zur Begrüßung steht sie auf, entschuldigt ihre Langsamkeit, von der man gar nichts merkt, mit »Moment, ich hab doch acht Schrauben im Rücken, meine Lieben«. Sie wirkt nahbar, fast kumpelig, bittet darum, sich mit Vornamen anzusprechen. Sie scheint unkompliziert, wach im Kopf und so leibhaftig, viel verletzlicher als aus der Ferne.
Alice Schwarzer ist so bekannt wie umstritten. Zur Feministin wurde sie in Paris, in Deutschland brachte sie 1971 die berühmte Stern-Titelgeschichte »Wir haben abgetrieben!« auf den Weg, ihr Buch "Der kleine Unterschied" von 1975 war für viele Frauen ein Erweckungserlebnis. Seitdem hat sie viele Kämpfe für Frauenrechte ausgetragen, seit 45 Jahren gibt es ihre Zeitschrift EMMA. Über die Jahre hat sich Alice Schwarzer viele Feinde gemacht, wegen ihrer politischen Positionen, aber auch als Gesicht einer Werbekampagne für die Bild-Zeitung und eines Schweizer Kontos.
Geboren wurde Alice Schwarzer 1942, drei Jahre vor Ende des Zweiten Weltkriegs, in Wuppertal. Ihre unverheiratete Mutter ließ sie bei den Großeltern zurück. In Paris war sie zehn Jahre mit einem Franzosen liiert, seit vier Jahren ist sie mit der Fotografin Bettina Flitner verheiratet, die beiden sind seit über 30 Jahren ein Paar.
SZ-Magazin: Frau Schwarzer, am 3. Dezember werden Sie 80 Jahre alt. Wie wichtig sind Ihnen Geburtstage?
Alice Schwarzer: Ich nehme sie ziemlich ernst. Als ich 23 Jahre alt wurde – der erste Geburtstag mit meinem damaligen Lebensgefährten Bruno –, schlug ich morgens die Augen auf, um zu gucken, wo meine Blumen und Geburtstagstorte sind. Als ich ein nicht eingepacktes Buch da liegen sah, habe ich vor Enttäuschung angefangen zu weinen.
Feiern Sie?
Der Nation entgeht ja nicht, dass ich 80 werde. Schon seit ich Ende 50 war, wurde vorauseilend mein Alter geschrieben, in jeder Dreizeilenmeldung steht seither gefühlte fünf Mal, wie alt die Alt-Feministin ist. Man hofft anscheinend, dass der Feminismus, zumindest der meine, sich bald mal zur Ruhe setzt. Ich muss also damit leben, dass mein Älterwerden öffentlich ist. Aber groß feiern, über ein Essen mit drei Dutzend Menschen hinaus, werde ich diesmal nicht.
Wen laden Sie ein?
In diesem Jahr sind tatsächlich zwei Mädchen aus meiner Jugend-Clique dabei – ich sage Mädchen, denn wir verstehen uns bis heute als Mädchen, wilde Mädchen. Zwischen 16 und 19 hatte ich so eine terrible Mädchenclique, die zwei kommen zum ersten Mal, weil sich unsere Leben doch sehr auseinanderentwickelt haben. Meine beste Freundin Barbara gehörte auch zu der Clique, sie ist leider tot.
Wer fehlt noch in so einer Runde?
Es wäre natürlich schön, wenn Bruno noch leben würde, er ist erst vor ein paar Jahren gestorben. Wenn ich noch größer träumen darf, hätte ich gern meinen Großvater dabei.
Mit ihrem französischen Freund Bruno waren Sie von Mitte der Sechzigerjahre an für zehn Jahre zusammen. Spannend, dass Sie ihn als einen der Ersten nennen. Sind Sie immer befreundet geblieben?
Ja, bis zu seinem Lebensende. Es ist ja schön, wenn Menschen, die ein Stück des Lebens mit einem geteilt haben, nicht verloren gehen. Wenn Menschen sich nach langer Zeit trennen und nichts mehr miteinander zu tun haben, bricht ein Stück gemeinsames Leben weg, das empfinde ich als Verlust.
Sind Ihnen dennoch Menschen unterwegs verloren gegangen?
Selten. Ich bin sehr treu in Freundschaften.
Und Ihr Großvater fehlt Ihnen bis heute?
Ja. Mein Großvater war meine soziale Mutter. Er hat mich gewickelt, er hat mich gefüttert. Ich vermute mal, ich verdanke ihm mein Leben. Der Schmerz über einen solchen Verlust bleibt ein Leben lang. Manchmal erschrecke ich, wie nah das noch ist. Man ist ja nicht nur der Mensch im Jetzt, sondern die Summe all der Menschen, die man mal war.
Sie verdanken Ihrem Großvater Ihr Leben?
Ich kam kurz nach der Bombennacht in Wuppertal im Juni 1943 in ein Kinderheim in Pforzheim. Mein Großvater hat mich da wieder rausgeholt. Meine Großmutter sagte oft: Wer weiß, wo du ohne ihn gelandet wärst. Sehr klug von ihr, ihn dafür zu loben, dass er sich so um mich kümmerte. Sie hat seine Fürsorglichkeit immer gefördert, auch weil sie null Ehrgeiz hatte, den Platz der Mutter einzunehmen. Mir soll niemand was erzählen über von Natur aus mütterliche Frauen. Sie las lieber und debattierte über Politik. Aber das Verhältnis von mir zu meinem Großvater war ganz und gar gleichberechtigt.
Wie meinen Sie das?
Erst hat er mich gerettet, dann habe ich ihn beschützt.
Wovor?
Vor seiner Frau. Wenn meine Großmutter Szenen gemacht hat – wir kennen ja die Szenen der Frauen! –, konnte nur ich sie stoppen.
Wie war Ihre Großmutter?
Sie war sehr mutig. Dazu muss man wissen, sie war klein und eigentlich sehr schüchtern. Aber sie hat die Nazis gehasst und hatte einen extremen Gerechtigkeitssinn. Nach der Reichspogromnacht ist sie in jeden als jüdisch gebrandmarkten Laden gegangen, jedes Mal durch ein SS-Spalier. Und sie hat Zwangsarbeiter durchgefüttert. Ich fand das später selbstverständlich. Erst 1995, bei einem Gedenktag in Ravensbrück wurde mir klar: Dafür konnte man schon ins KZ kommen. Auch nach dem Krieg blieb sie sehr regimekritisch. Wenn sie aus der Stadt kam, sagte sie oft empört: Da sitzen immer noch die alten Nazi-Bonzen auf demselben Platz. Meinem Großvater aber hat sie das Leben so manches Mal zur Hölle gemacht. Sie hielt ihn für schuldig an ihrem begrenzten Frauenleben.
Was nimmt man als Beobachterin einer solchen Ehe mit in ein eigenes Beziehungsleben?
Man tut als gebranntes Kind das Gegenteil. Ich habe immer nach voll gleichberechtigten Beziehungen gestrebt. Und vor allem: Ich hatte nie nur Leidenschaft für den einen Menschen, sondern auch Leidenschaft für den Beruf und die Politik.
Wäre Ihre Großmutter eine andere Frau gewesen, wenn sie gearbeitet hätte?
Und ob! Sie hätte raus in die Welt gehört. Sie war der klassische Fall einer Frau, bei der es destruktiv war, sie als Hausfrau einzusperren. Noch zwei Tage vor ihrem Tod hat sie zu ihrer Tochter gesagt: »Das verzeihe ich meinem Vater nie, dass nur meine Brüder studieren durften.«
Ihre Mutter war 22 Jahre alt, als Sie geboren wurden. In Ihren Biografien tritt sie kaum in Erscheinung, Ihr Vater – ein Soldat auf Heimaturlaub – gar nicht. Haben Sie Ihre Eltern vermisst?
Nein. Na ja. Vielleicht ein bisschen, als kleines Mädchen die Mutter. Aber ich habe ja zu den Großeltern Mama und Papa gesagt, ich bin kein Kind, dem Eltern fehlten. Meine Mutter hatte eher den Status einer älteren Schwester – und später den einer jüngeren Schwester.
Sie sind nicht im Hader mit Ihrer Mutter?
Nein, bin ich nicht. Wir waren wie die beiden Töchter meiner Großeltern. Sie aber ist von ihrer Mutter nicht geliebt, vielleicht sogar verachtet worden. Das ist immer schwierig und war bei uns besonders schwierig, weil ich von der Großmutter auf ihre Art geliebt und geachtet wurde. Meine Mutter war sehr selbstbewusst, hat aber ihr Leben beruflich in den Sand gesetzt. Eigentlich hat sie immer um die Anerkennung ihrer Mutter gebuhlt. Ich habe mich bis zuletzt um meine Mutter gekümmert, auch ökonomisch. Aber sie war eine eher anstrengende Schwester, die Unsinn machte und die Schulden beim Krämer nicht bezahlte.
Sind Sie sich in irgendeiner Weise ähnlich?
Manchmal sehe ich Bewegungen an mir und denke: Da sehe ich ja aus wie die Mutti. Aber im meisten bin ich das totale Gegenteil. Ich bin sehr verantwortungsbewusst.
Wurden Sie von Ihrer Mutter geliebt?
Bei meiner Mutter habe ich mich eher gefragt, ob sie überhaupt lieben konnte.
Haben Sie Ihre Mutter auch mal toll gefunden?
Durchaus. Sie hatte so eine schillernde Attraktivität, die Männer nervös machte. Sie trug gern Dekolletees, rauchte auf der Straße und trug extravagante Hüte, das fand ich schick. Aber ich sah auch das Nicht-Eingelöste. Ich bin bis heute empfindlich in Bezug auf die Kluft zwischen Behauptetem und nicht Eingelöstem.
Was war als Teenager Ihre größte Sehnsucht?
Eigentlich bin ich ein Mensch, der immer sehr im Jetzt lebt. Aber ich erinnere mich daran, wie ich 1957 Monpti gesehen habe, für damalige Zeiten ein leicht frivoler Liebesfilm. Er spielt in Paris, mit Romy Schneider und Horst Buchholz. Die beiden wohnen unterm Dach, und Romy trug große schwarze Hüte und sagt zu Horst Buchholz Sätze wie: »Wenn du mich liebst, holst du mir Seidenstrümpfe.« So was fanden wir früher aufregend, schon mit 19 wollte ich nach Paris. Aber das hat meine sehr frankophile Großmutter verboten: »Wie stellst du dir das vor, willst du unter den Brücken leben?« Der tödliche Satz war: »Sie wird wie ihre Mutter.« Nein, wird sie nicht, dachte ich, sie macht das schon. Also bin ich nach München gegangen, das war damals angesagt.
Wo Sie aber nicht lange geblieben sind. Ihr Münchner Freund hat Ihnen einen Heiratsantrag gemacht, und dann sind Sie schnell nach Paris gezogen. Sind Sie vor ihm weggelaufen?
Er war eigentlich ein netter Mensch, ich habe inzwischen ein schlechtes Gewissen, dass er in meiner Autobiografie relativ schlecht wegkommt. Aber er war ein Mann seiner Generation. Ein Mann, der eine rebellische junge Frau wie mich interessant fand – aber dann doch umerziehen wollte. Außerdem war ich nicht der Typ Ehefrau.
Mit Bruno aber schon. Da besorgen Sie sogar schon die Heiratspapiere.
Damals gab es noch keine EU, die Franzosen hätten mich als linke politische Korrespondentin jederzeit ausweisen können. Es war also mehr eine Sicherheitsfrage als eine romantische. Ich meine, im Herbst 1969, was waren das für Zeiten, da wollten nur Trottel heiraten. Auch war Bruno eigentlich nicht der Mann, der von einer Familie träumte. Aber wir hatten uns das auch deshalb vorgenommen, damit seine großbürgerliche Familie mal Respekt vor mir bekommt. Dann ist es uns irgendwie wieder weggerutscht.
Haben Sie in der Beziehung mit Bruno eine Seite von sich entdeckt, die Sie vorher nicht kannten?
Nein. Wichtig war immer für mich Gleichheit. Augenhöhe. Und das war den Männern meiner Generation ja nicht an der Wiege gesungen worden. Die haben sich zwar für eine selbstbewusste Frau wie mich interessiert – aber fanden es auch unbequem. Als ich einmal neben meinem Freund in München am »Nest« vorbeiging, dem legendären In-Café auf der Leopoldstraße, da sagte er zu mir: Alice, eine Frau macht nicht so große Schritte. Da habe ich vor Wut, dass ich von ihm so gemaßregelt werde, meine Handtasche auf den Boden geworfen und bin darauf rumgetrampelt. Dabei war er einer der fortschrittlichen Männer, die hörten Jazz, trugen schwarze Rollkragenpullover und zitierten Boris Vian. Aber es waren eben auch Männer ihrer Zeit.
Woran machen Sie fest, dass Sie mit Bruno eine Beziehung auf Augenhöhe hatten?
Er hat Rücksicht auf mich genommen, ich habe Rücksicht auf ihn genommen. Er hat meine Leidenschaft für den Journalismus respektiert, wenn ich abends lange gearbeitet habe. Und ich habe respektiert, dass er nicht so lebenstüchtig war wie ich. Und als ich 1970 anfing, mich in der Frauenbewegung zu engagieren, fand er das selbstverständlich. Und ich habe gleichzeitig verstanden, dass er sich trotzdem mit meinem Freiheitsdrang manchmal schwertat.
Sie haben in Paris Simone de Beauvoir und Jean-Paul Sartre kennengelernt, die damals schon sehr berühmt waren. Waren Sie ehrfürchtig?
Ehrfurcht ist mir fremd. Das war eine Zeit, in der wir in Paris alle zusammen die Welt verändern wollten, im politischen Milieu nach 1968 gab es keine Schranken zwischen Studenten und berühmten Intellektuellen. Auch die Frauenbewegung war wahnsinnig gemischt. Eine meiner besten Freundinnen war die Schauspielerin Delphine Seyrig, damals ein Star wie Jeanne Moreau, sie ist leider sehr früh gestorben. Natürlich war mir immer bewusst, wer Beauvoir und Sartre sind. Gerade Beauvoir hat ja meine Frauengeneration stark geprägt, nicht nur mit ihrem Werk, auch mit ihrem Leben – freie Liebe, Engagement für die Revolutionen in der Welt, alles ganz groß!
Hatten Sie so etwas wie Respekt vor der Lebenserfahrung der beiden?
Selbstverständlich. Respekt ist die eine Sache, doch eine andere ist es, sich kleinzumachen. Man war sich in dieser Zeit auch des Altersunterschieds nicht so bewusst. Beide hatten eine Schwäche für junge Leute, ließen sich gerne infrage stellen oder mitreißen. Sie hatten kein Interesse, im Ruhm zu erstarren. Es war die Zeit, in der Sartre der Weggefährte der Maoisten war und Beauvoir die Weggefährtin von uns radikalen Feministinnen. Beide sahen sich nicht als Vordenker, sie haben sich den radikalen Bewegungen angeschlossen und zur Verfügung gestellt. Wobei man sagen muss: Beauvoir war immer die Radikalste, sie war immer für den Regelbruch. Und gleichzeitig war sie so rührend konventionell, mit ihrer Handtasche auf dem Schoß.
Ist sie eine warme Frau gewesen?
Man kennt sie ja als diese schroffe Person. Aber in Wahrheit war sie schüchtern. Und sie musste sich auch schützen. War man einmal zu ihr durchgedrungen, war sie total einfühlsam, anrührend, herzlich, interessiert am Leben der anderen. Auf der alltäglichen Ebene wie politisch. Sie schrieb in Zeiten des Algerienkriegs, in dem furchtbare Dinge seitens der Franzosen passierten, an ihren Memoiren. Da hat sie Nächte durchgeweint vor Mitgefühl mit den Algeriern und Scham für ihr Land.
Haben Sie das Gefühl, Sie hat Ihnen einen feministischen Staffelstab übergeben?
Nein. Ich baue wie andere Feministinnen auf Beauvoir auf, das ist klar. Auf ihrem Werk sowieso, aber auch auf ihrem Leben und ihrem Mut. Aber so eine heroische Staffelübergabe – dieses Denken wäre uns beiden fremd. Die Frauenbewegung war ja ein kollektiver Aufbruch, ganz wie die Klimabewegung.
Wenn Beauvoir auferstehen und Sie anrufen würde, was würden Sie ihr als Erstes erzählen?
Ich würde sagen: »Stellen Sie sich vor, Simone, Sie haben ja noch Bettina kennengelernt, sie hat Sie fotografiert, erinnern Sie sich? Ich bin immer noch mit ihr zusammen. Was sagen Sie jetzt!«
Was hätte sie geantwortet?
Sie hätte gesagt: »Ja, ich erinnere mich gut. Sie ist ja hinreißend.« Es war so angenehm für mich, in Beauvoir eine Person zu haben, der ich privat vertraut und die ich politisch respektiert habe – und die ich um Rat fragen konnte. Ich habe zum Beispiel 1979 dafür plädiert, dass Frauen einen uneingeschränkten, freiwilligen Zugang zur Bundeswehr haben, ausgehend von einer Fernsehsendung über Wehrdienstverweigerer, das waren natürlich nur Männer. Da habe ich am nächsten Tag einen Text darüber geschrieben, dass ich auch Kriegsdienstverweigerin wäre, aber dass Frauen in Deutschland noch nicht einmal den Wehrdienst verweigern dürfen, geschweige denn ausüben. Ich muss gestehen, ich denke ganz gern quer, wenn mir etwas wirklich wichtig ist. Wie jetzt, mit dem von mir initiierten Offenen Brief an Kanzler Scholz gegen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine und für Verhandlungen. Der hat inzwischen 500 000 Unterzeichner und Unterzeichnerinnen. Damals waren alle gegen mich, ich bekam viel Ärger. Von Konservativen sowieso. Aber auch von Feministinnen und Linken. Ich wurde als »Flintenweib« beschimpft. Da sagte ich mir: Verdammt, ich liege doch richtig, oder? Es geht um die Frage der Geschlechtergerechtigkeit. Also bin ich zu Beauvoir und habe sie gefragt. Selbstverständlich müssen Frauen dieselben Rechte haben, antwortete sie auf ihre rigorose Art. »Auch in der Armee.«
Sie unterbricht das Gespräch, denn gerade erscheint Bettina Flitner, um sie abzuholen. Sie sagt mit ganz warmer Stimme zu ihr: »Da bist du ja schon, Bettina, du warst gerade im Gespräch, wie hinreißend du bist. Aber jetzt bist zu leider viel zu früh.« Bettina Flitner lächelt und sagt, sie werde in einer Dreiviertelstunde wiederkommen. Dann kann das Interview weitergehen.
1971 haben Sie in Deutschland mit einer Titelgeschichte im Stern für Aufsehen gesorgt: »Wir haben abgetrieben!«
Ich hatte diese Aktion aus Frankreich exportiert, ich lebte und arbeitete ja in Paris. Und musste mich zu guter Letzt mit dem Chefredakteur Henri Nannen anlegen, weil er nur Romy Schneider auf dem Titel haben wollte. Aber ich wollte, dass ganz viele Frauen auf dem Titel zu sehen sind, damit die Leserinnen sich identifizieren konnten. Also habe ich gesagt: Ihr kriegt die Liste der 374 Unterzeichnerinnen nur, wenn wir es so machen wie abgemacht: ein Kollektivtitel. Nannen war außer sich. Zuvor hatte ich von Paris aus ab und zu für den Stern geschrieben, aber danach war der Ofen erst mal aus.
Die Veröffentlichung war ein Riesenerfolg für den Stern.
Ja, sicher. Aber Nannen erklärte: Die Schwarzer soll mir nicht mehr vor die Augen kommen. Ich habe mich als Journalistin mit meinem feministischen Engagement oft verbrannt. »Früher warst du doch so eine tolle Journalistin«, hieß es dann in den Redaktionen. »Aber heute kommst du nur noch mit deinen Frauen.«
Sie waren in Paris Teil der französischen Frauenbewegung. Wie haben Sie im Vergleich dazu die deutsche Frauenbewegung erlebt?
Die war mir ein bisschen fremd. Der Frauenbund in Berlin war kommunistisch, die Weiberräte in Frankfurt machten von morgens bis abends Marx-Schulungen. Da war ich schon weiter.
Was heißt das?
Die französische Frauenbewegung war nicht nur entschieden feministisch, sondern auch breiter, gemischter, von 18 bis 80 Jahre, durch alle sozialen Schichten, sehr kosmopolitisch. Meine engsten Freundinnen waren: eine algerische Jüdin, eine Russin, eine Brasilianerin, eine Isländerin. In Deutschland war es eine sehr studentische Bewegung. Als es später die EMMA gab, schrieb zum Beispiel eine Leserin: »Ach, ich bin so froh, dass es euch jetzt gibt. Ich lebe hier in Sowieso, einer mittelgroßen Stadt, da war ich im Frauenzentrum und wurde schräg angeschaut, weil ich eine weiße Bluse und einen Rock trug.« Diese Frauen wussten nicht, wohin. In der frühen deutschen Frauenbewegung trug man Jeans und Parka und redete Soziologendeutsch. Das hatte mit dem Leben vieler Frauen nichts zu tun. Das ist wohl einer der Gründe, warum ich so viel erreicht habe: weil ich immer dicht am Leben bin. Man darf keine Zeit verlieren. Ich bin am Kommunizieren und Wirken interessiert, am Handeln, nicht an Ideologien.
Aber manchmal braucht man Zeit, um zu überlegen, für Zweifel – auch damit man keine Fehler macht.
Natürlich. Wer viel handelt, macht Fehler. Ich mache ungern Fehler, aber ich habe auch keine Angst davor.
In den vergangenen Jahren haben Sie sich immer wieder an gesellschaftspolitischen Debatten beteiligt. Von den Rechten von trans Menschen bis zum Kopftuch. Oft wurden Sie für Ihre ¬Positionen kritisiert. Haben Sie sich missverstanden gefühlt?
Ja! Und ich finde es bemerkenswert, dass man mich so gerne missversteht, weil ich ja alles aufschreibe. Und man es nachlesen kann. Diese angeblichen Missverständnisse sind eine Methode meiner Gegner, um mich zu diskreditieren. Als ich ein paar Wochen nach der Machtergreifung von Khomeini 1979 mit französischen Intellektuellen nach Iran gefahren bin, auf den Hilferuf von Frauen hin, die gegen die plötzlich deklarierte Zwangsverschleierung auf die Straße gegangen waren, habe ich früh begriffen, was das Kopftuch ist: ein Symbol, die Flagge des politischen Islam. Darüber habe ich schon 1979 geschrieben. Dass der politische Islam der Faschismus des 21. Jahrhunderts ist, war für mich früh klar. Wir sehen das auch jetzt wieder am Gewaltregime in Iran – und wir sehen das an der Agitation und dem Terror der Islamisten in der ganzen Welt, auch in der westlichen.
Es gibt sicher Frauen, die darüber froh sind, dass sie in Deutschland nicht gezwungen sind, ein Kopftuch zu tragen. Aber wenn eine Frau sagt, sie möchte ein Kopftuch tragen, weil sie sich damit Gott näher fühlt – würden Sie dann sagen: Das ist feministische Selbstbestimmung, natürlich kann sie das machen?
Selbstverständlich kann jede und jeder tun, was er oder sie möchte. Solange man damit nicht Dritten schadet. Ich habe Menschen nicht vorzuschreiben, wie sie leben sollen. Wenn eine sagt: Ich trage das Kopftuch und fühle mich dadurch Gott näher, würde ich sagen: Schön für dich. Aber mit Feminismus hat das nichts zu tun. Ich habe allerdings im Gegensatz zu dem, was penetrant behauptet wird, noch nie ein Wort zum Islam verloren. So wenig wie zum Christentum. Religion ist Privatsache. Aber Politik im Namen des Glaubens nicht. Ich begegne jeder Kopftuchträgerin höflich. Aber wenn ein Gespräch gewünscht ist, würde ich sagen: Ist dir klar, was für ein Symbol das ist? Wofür es heute in der Welt steht? Nicht nur für die Tausenden Ermordeten in Iran, sondern für Millionen entrechtete und unterdrückte Menschen in der ganzen islamischen Welt. Ganz wie einst das Hakenkreuz.
Sie vergleichen das Kopftuch mit dem Hakenkreuz?
Ja. Es ist das Symbol der faschistoiden Islamisten. Sie nehmen den Glauben in Geiselhaft, so wie das Hakenkreuz, das Symbol der Nationalsozialisten, die Hoffnung auf eine sozialere Welt und gleichzeitig das Herrenmenschentum. Es gibt kein religiöses Gebot, das Kopftuch zu tragen. Es ist eine düstere patriarchale Tradition, die vom politischen Islam wiedererweckt wurde. Im Namen des Kopftuchs werden Frauen entrechtet, unterdrückt, gefoltert, getötet. Mit welcher Rührung schauen wir uns heute die Bilder der todesmutigen Frauen mit offenem Haar in Iran an! Mein Gott, dass sie es wagen! Wie stolz sie den Kopf heben und ihr Leben dafür riskieren! Da kann ich doch ein Kopftuch nicht mehr in Unschuld tragen!
Im März ist ein Sammelband erschienen, den Sie gemeinsam mit ihrer EMMA-Kollegin Chantal Louis herausgegeben haben. Es heißt: Transsexualität. Was ist eine Frau? Was ist ein Mann? – Eine Streitschrift. Verstehen Sie, dass trans Menschen sich von der Veröffentlichung angegriffen fühlen?
Überhaupt nicht. Für jeden, der es wissen will, dürfte bekannt sein, dass ich mich seit 1984 öffentlich einsetze für die Rechte von echt transsexuellen Menschen.
Was sind denn »echt transsexuelle Menschen«?
Ganz einfach Menschen, die auch nach Reflexion, Befragung und Angeboten von Therapie tief unglücklich nicht nur über ihre Geschlechterrolle sind, sondern auch über ihren Körper, in dem sie leben, und die in manchen Fällen sogar bis zur Selbstverstümmelung gehen. Ich bin dafür, dass diese Menschen ihren Personenstand ändern können. Ich war sogar eine der Ersten, die dafür waren, dass man das auch tun kann ohne operative oder hormonelle Behandlung. Was mir Sorgen macht, ist die dramatisch steigende Zahl junger Leute, vor allem Mädchen, die heute die Praxen stürmen und sagen: Ich bin trans. Gloria Steinem oder Joanne K. Rowling oder ich – wir erfahrenen Feministinnen sind alarmiert und einig, dass diese jungen Frauen einen schweren Konflikt mit ihrer Geschlechterrolle haben – aber deswegen nicht lebenslang gefährliche Hormone schlucken oder sich gar die Brüste abnehmen und die Genitalien verstümmeln müssen.
Warum glauben Sie das?
Das ist keine Frage von Glauben, sondern von Wissen. Wir leben in Zeiten, die für junge Frauen schwieriger sind denn je. Die Botschaften sind so widersprüchlich! Einerseits wird ihnen gesagt: Du kannst Astronautin werden oder Bundeskanzlerin. Alle Berufe stehen dir offen. Aber gleichzeitig musst du immer schön ganz Frau bleiben. Diese Influencerinnen und der ganze rosa Kram – die sogenannte Weiblichkeit. Diese unvorstellbaren Zwänge, wie man auszusehen hat, hat es so in unserer modernen Zeit noch nicht gegeben. Aber: Was ist überhaupt eine Frau? Diese Mädchen sagen jetzt: Ich möchte keine Frau sein. Kinder, wer versteht das besser als Alice Schwarzer? Ich sage seit 50 Jahren allen Frauen: Ihr müsst keine Frau sein! Ihr könnt einfach ein Mensch sein. Spielt Fußball! Verliebt euch in eure Freundin! Völlig egal. Raus aus der Schublade! Doch jetzt macht man diesen Mädchen ein gefährliches Angebot: Du willst keine Frau sein? In Ordnung. Dann bist du eben ein Mann! Eine kleine Anmerkung von mir, liebe Kameradinnen und Kameraden: Es geht nicht binärer. Zwei Schubladen – und nichts dazwischen!
Es gibt auch Menschen, die sagen: Ich bin non-binär. Ich bin nichts davon.
Prima. Nur dürfen sie nicht die Utopie mit der Realität verwechseln. Die Begriffe wechseln. Doch wenn Sie meinen Kleinen Unterschied von 1975 lesen, werden Sie sehen, dass der ein einziges non-binäres Programm ist. Das feministische Kernziel ist ja – neben sozialer Gerechtigkeit und Gewaltfreiheit – die Abschaffung der Geschlechterrollen, die Frauen wie Männer einengen, ja verstümmeln. Das Ziel ist der ganze Mensch!
Sie behaupten, dass diese jungen Menschen einen Rollenkonflikt hätten. Woher nehmen Sie die Gewissheit, die Lage besser einschätzen zu können als die Betroffenen selbst?
Ich stehe immer im Verdacht, es besser wissen zu wollen. Aber ich sage nur: Es muss zu Ende gedacht werden. Die Zeit der Pubertät ist die Zeit der größten Verwirrung. Sollen wir in dieser Lebenszeit Pubertätsblocker einsetzen? Das halte nicht nur ich für sehr gefährlich, die Folgen einer lebenslangen Hormontherapie sind noch gar nicht erforscht. Oder sogar die Brüste abnehmen und Genitalien verstümmeln? Es geht hier um das Risiko schwerer psychischer und physischer Schäden. Ich respektiere, wenn ein Mensch wirklich transsexuell ist. Ich kritisiere die Trans-Propaganda, die dafür ist, dass schon 14-Jährige transitionieren können, gegebenenfalls auch ohne Zustimmung der Eltern. Ich sage Ja zu der Möglichkeit einer Geschlechtsangleichung ab 18. Und zu einem Weg, auf dem man dabei beraten wird. Aber doch nicht mit 14!
In diesem Fall sind Sie für verpflichtende Beratungsgespräche. Beim Thema Abtreibung setzen Sie sich seit Jahrzehnten dagegen ein. Wie passt das zusammen?
Jetzt wollen wir mal unter Frauen reden. Nehmen wir an, Sie sind unerwünscht schwanger. Es hat auch in meinem Leben Momente gegeben, wo ich gedacht habe, ich sei schwanger. Und ich hatte Angst vor einer Abtreibung – nicht aus moralischen Gründen, sondern aus Angst um mein Leben. Eine Frau, die abtreibt, tut das nicht jubelnd. Das ist eine Entscheidung, ein Konflikt. Aber das ist ein total schiefer Vergleich. Der Schwangerschaftsabbruch ist ein kleiner ¬medizinischer Eingriff – weniger gefährlich übrigens als eine Geburt – für ungewollt Schwangere, die nicht Mutter werden wollen oder können – denn das würde ihr gesamtes zukünftiges Leben entscheidend bestimmen. Ein Geschlechterwechsel ist ein schwerer seelischer, sozialer und körperlicher Eingriff, bei dem durch Hormonbehandlungen und Operationen gesunde Körper schwer geschädigt werden. Diesen irreversiblen Schritt darf keine Minderjährige entscheiden können. Und schon gar nicht darf sie der faktenfreien, aber verführerischen Propaganda der Translobby ausgeliefert sein.
Wer propagiert es denn?
Unter anderem Staatssekretär Lehmann!
Sie sprechen von Sven Lehmann, dem Beauftragten der Bundesregierung für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt.
Sehr interessant, dass man im Jahr 2022 als gut bezahlter Staatssekretär ideologische Propaganda machen darf. Und dann kommt noch etwas hinzu: Mit dem von der Bundesregierung allen Ernstes geplanten Gesetz würden die Kategorien »Mann« bzw. »Frau« relativiert. Doch die sind nicht nur eine biologische, sondern auch eine soziale und politische Realität. Denn nach diesem sogenannten Selbstbestimmungsgesetz würde jeder Mensch einmal im Jahr das Geschlecht wechseln können, nur durch einen »Sprechakt«, indem er oder sie beim Standesamt erklärt: Ich bin jetzt ein Mann bzw. eine Frau. Es könnte keine Statistiken mehr geben über Lohnunterschiede zwischen den Geschlechtern oder Femizide und keine Gendermedizin zum Beispiel. Das alles hätte ungeahnte gesellschaftliche Folgen. Darum hat zum Beispiel England gerade das wie in Deutschland geplante Gesetz gestoppt und rudert in allem zurück.
Was stört Sie daran so, dass jemand seinen Personenstand einfacher ändern kann? So viele werden es doch nicht sein, dass Statistiken nicht mehr gelten. Und für den Einzelnen in seinem Dilemma wäre es doch die beste Lösung.
Wissen Sie was, liebe Kolleginnen, ich bitte noch heute den Verlag, Ihnen zwei Exemplare des von mir und Chantal Louis herausgegebenen Buches zu schicken. Das müsste alle Fragen beantworten.
Bettina Flitner kommt wieder und will Alice Schwarzer jetzt wirklich abholen. Schwarzer sagt: »Setzt du dich da vorne hin? Da hole ich dich ab!«
Wenn Sie als private Alice Schwarzer auf die öffentliche Figur Alice Schwarzer schauen. Gefällt Ihnen, was Sie sehen?
Nein, die gefällt mir nicht. Ich finde die Klischees über Feministinnen einfach zum Kotzen. Nur weil ich Mitte der 1970er-Jahre schon eine gewisse Lebenserfahrung und feministisches Bewusstsein hatte, habe ich diese Demütigungen überstanden. Ich habe Humor und nichts gegen Männer. Wenn man sich meinen Lebenslauf anguckt, dürfte das eigentlich klar sein. Und dass ich das überhaupt sagen muss, ist aberwitzig. Aber das geht ja bis heute. Seit 50 Jahren!
Ihre Fehler werden öffentlich ausgetragen, das dürfte Ihnen wahrscheinlich auch nicht gefallen. Gibt es einen darunter, den Sie wirklich bereuen?
Ja, die Steueraffäre. Wobei die Reaktion nicht im Verhältnis stand zur Sache.
In Ihrem Buch Mein Leben schreiben Sie: »Ich erinnere mich sehr genau an mein Gefühl der Beklemmung und des Ausgeliefertseins«. Sie erklären, dass Sie daraus gelernt hätten. Was denn?
Ich habe gelernt, dass ich lieber mehr Steuern zahle als weniger. Ich habe aus Schlamperei diesen Fehler gemacht. Darauf bin ich nicht stolz. Aber man muss auch mal sagen: Zinsen eines Kontos nicht zu versteuern ist eine Sache. Die Namen, mit denen ich da in einem Atemzug genannt wurde, sind noch mal eine andere.
War es aus Ihrer Sicht ein Fehler, dass Sie Werbung für die Bild-Zeitung gemacht haben?
Werbung? Ich habe an einer Imagekampagne teilgenommen, vor gefühlt 20 Jahren. Ich war die einzige Frau, neben Gandhi und Willy Brandt. Ich würde nicht sagen, dass das ein Fehler war. Ich hätte es mir nur wirklich sparen können. Aber man ist ja vor Eitelkeit nicht immer geschützt. Den Kachelmann-Prozess für die Bild-Zeitung kommentiert zu haben, nachdem die gesamten Leitmedien Monate vor Beginn des Prozesses schon wussten, dass das mutmaßliche Opfer lügt – darauf bin ich stolz.
Warum?
Weil ich dem mutmaßlichen Opfer eine Stimme gegeben habe. Gegen alle. Sie werden von mir nicht eine Zeile finden, in der ich geschrieben hätte: Kachelmann war es. Ich habe nur immer gesagt: Die Unschuldsvermutung gilt auch für das mutmaßliche Opfer. Der Richter hat nach acht Monaten Prozess dasselbe gesagt: Er hat Kachelmann freigesprochen, aber nicht rehabilitiert. Wenn wir Unrecht nicht beweisen können, dann können wir nicht verurteilen, das ist der Rechtsstaat, gut so. Der Richter hat sich in der Urteilsverkündung sehr ausführlich an die Medien gewandt und gesagt: Es kann sein, dass Kachelmann die Wahrheit sagt; es kann aber auch sein, dass er lügt. Es kann sein, dass das Opfer die Wahrheit sagt, es kann aber auch sein, dass es lügt. Wir konnten es nicht herausfinden. – Die Medien aber sind aus dem Saal gestürmt und haben geschrieben: Kachelmann ist unschuldig! Sie hat gelogen!
Die Publizistin Teresa Bücker schrieb 2017 in der taz zum 40. Geburtstag der EMMA: »Daher bedauere ich, dass EMMA nicht zu einer Plattform geworden ist, die viele Feministinnen zu einer so starken öffentlichen Person gemacht hat, wie es Schwarzer selbst ist. Dass die EMMA nicht zu einer Bühne von intellektuellen, aktiven und -mitreißenden Frauen geworden ist, die miteinander streiten.«
Hört sich gut an. Aber in zentralen politischen feministischen Fragen trennen uns – also die EMMA – Welten von Teresa Bücker. Ich komme ideologisch aus der Linken und mir liegt auch sehr an sozialer Gerechtigkeit und einem bewussten Blick auf die Welt. Edition F hat sich seine Frauenpreise von Mercedes und Veuve Clicquot sponsern lassen – nichts dagegen, aber das ist eine andere politische Welt. (Teresa Bücker war von 2017 bis 2019 Chefredakteurin der Online-Plattform Edition F und ist regelmäßige Kolumnistin des SZ-Magazins, Anm. der Red.) Das ist keine Generationenfrage. Wissen, Sie, ich bin die Allererste, die begeistert ist, wenn Frauen Macht haben und gut verdienen. Aber irgendwann dachte ich: Kinder, das kann es doch nicht nur sein. Wir können jetzt nicht dauernd nur über Quoten reden – bei der Weltlage, bei der Lage in unserem Land! Ich bin eine klassenbewusste universalistische Feministin. Als Feministin kritisiere ich auch den Kapitalismus. Wir sehen ja, wohin der führt.
Eine intime Frage: Sie haben sich spät geoutet. Was war das für ein Gefühl?
Was heißt spät geoutet? Ich war seit dem Kleinen Unterschied die Lesbe der Nation!
Aber nicht öffentlich.
Aber sicher! Ich bin Feministin, also bin ich »lesbisch«. Das war mein Ruf. Selbst, als ich noch mit einem Mann zusammen war.
Wie haben Sie Ihre Beziehungen gelebt?
Bettina Flitner und ich sind seit über 30 Jahren zusammen. Wir waren immer ein offenes Paar, aber kein öffentliches. Wir wollten nicht Futter für die Medien werden.
Sie haben es also nicht mit Absicht verschwiegen?
Niemals.
Verstehen Sie, dass Rosa von Praunheim, der »die Alice Schwarzer der Schwulenszene« genannt wird, Ihnen das übel nimmt?
Ich schätze Praunheims große Verdienste in Bezug auf die Sichtbarmachung und Emanzipation der Homosexuellen, Männer wie Frauen. Ich nehme Rosa von Praunheim aber auch etwas übel: das Zwangsouting. Ich war zum Beispiel mit Alfred Biolek befreundet, den er zwangsgeoutet hat. Ich habe Bioleks Schmerz erlebt. Das geht überhaupt nicht. Man sollte zu einer Gesellschaft beitragen, in der ein Mensch ohne Angst oder Scham homosexuelle Beziehungen haben kann. Aber man hat nicht das Recht, jemanden zwangszuouten. Und in meinem Fall – also, da lachen ja die Hühner, wenn Alice Schwarzer sagen würde: »Ach, übrigens, ich habe jetzt eine Frauenbeziehung.« Das denkt sich doch jeder. Ich habe schließlich schon 1975 klar für die Abschaffung der Zwangsheterosexualität und eine freie, nicht genormte Sexualität plädiert.
Alice Schwarzer zieht ihren schwarzen Mantel an, mit ihrer Ehefrau wird sie gleich nach Straßburg fahren. Am kommenden Abend wird dort auf einem Filmfestival der Dokumentarfilm von Sabine Derflinger über sie gezeigt, der in Deutschland Mitte September seinen Kinostart hatte. Es ist nicht die einzige Filmproduktion anlässlich ihres anstehenden runden Geburtstages: Am 30. November zeigt das Erste einen Zweiteiler, in dem Nina Gummich die junge Alice Schwarzer spielt. Alice Schwarzer hat den Film schon gesehen. Sie sagt: »Ich musste so lachen. Ich dachte, das bin ja ich. Bei der Trennung von Bruno war ich zu Tode gerührt. Ich hatte Tränen in den Augen.« Während sie lacht, lehnt sie sich an Flitners Schulter an. Dann verabschieden die beiden sich. Sie müssen jetzt rennen.
Das Gespräch führten Susan Djahangard und Gabriela Herpell, es erschien am 25.11. im Magazin der Süddeutschen Zeitung.