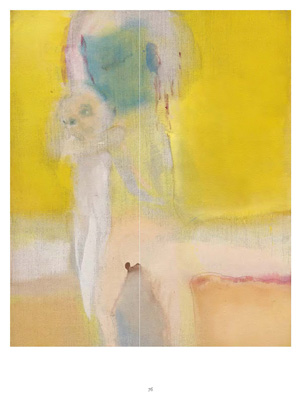Spiegel: Frau Schwarzer, Angela Merkel regiert Deutschland seit fast elf Jahren. Theresa May ist seit gut zwei Wochen britische Premierministerin, und Hillary Clinton könnte die erste Präsidentin der USA werden. Wird die Welt besser, wenn sie von Frauen regiert wird?
Schwarzer: Sie wird auf jeden Fall anders. Frauen haben eine andere Geschichte, eine andere Lebensrealität als Männer. Bis heute. Sie bringen also andere Erfahrungen ein. So hat Merkel in ihrer Kanzlerschaft von Anbeginn an einen sehr uneitlen, sachbezogenen Stil gepflegt, an dem sich Theresa May ganz offensichtlich orientiert. Es war kein Zufall, dass Mays erste Auslandsreise nach Berlin ging. Dort sagte sie den schönen Satz: „Wir sind zwei Frauen, die ihren Job machen.“
Spiegel: Woran liegt es, dass Frauen anders regieren?
Schwarzer: Bei den Hahnenkämpfen der Männer geht es ja immer darum, das Gesicht zu wahren. Frauen hatten jahrhundertelang gar kein Gesicht zu verlieren. Die einzige Ehre, die sie verlieren konnten, lag zwischen ihren Beinen. Und natürlich haben Frauen in den vergangenen Jahren begriffen, dass ihr Verhalten immer noch mit zweierlei Maßstäben gemessen wird. Wenn eine Frau nach oben will, ist sie eiskalt und karrieregeil. Bei Männern heißt es anerkennend: weiß sich durchzusetzen.
Spiegel: Im Grundsatzprogramm der SPD steht der Satz: „Wer die menschliche Gesellschaft will, muss die männliche überwinden.“ Ist das nicht ein bisschen naiv?
Schwarzer: Es ist schlicht und einfach das Recht der Frauen, die Hälfte der Macht für sich zu beanspruchen. Punkt. Ich hatte noch nie die Illusion, dass Frauen die Welt dann gerechter oder moralischer machen. Frauen sind nicht automatisch besser als Männer. Sie hatten in der Vergangenheit nur seltener Gelegenheit, sich die Hände schmutzig zu machen.
Spiegel: Wenn man Ihren Gedanken konsequent zu Ende denkt, heißt das: Irgendwann wird es einen weiblichen Hitler geben?
Schwarzer: Monster wie Hitler gab es ja nun nicht so oft in der Geschichte. Aber sicher: Wenn mehr Frauen an die Macht kommen, dann wird es auch welche geben, die diese missbrauchen.
Spiegel: Ist so gesehen der Aufstieg von rechtspopulistischen Politikerinnen wie Marine Le Pen und Frauke Petry eine Art Normalisierung?
Schwarzer: Ja. Frauen sind links und rechts. Fair und gemein. Schlau und dumm. Der Weg, den Marine Le Pen geht, ist übrigens sehr interessant. Ihr Vater war noch ein knallharter Rechter, ein Faschist und Antisemit. Marine Le Pen hat mit ihrem Vater gebrochen, sich für die Homo- Ehe ausgesprochen. Sie ist soft rechtspopulistisch. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich hege keine Sympathien für Le Pen, auch sie ist Nationalistin. Aber wenn man sich für Machtpolitik der Geschlechter interessiert, ist sie ein interessanter Fall.
Spiegel: Hat die Frauenbewegung die Leistungen von Margaret Thatcher, der konservativen britischen Premierministerin, zu wenig gewürdigt?
Schwarzer: Die linken Feministinnen ja. Sie müssen sehen, dass gerade die westdeutsche Frauenbewegung sehr im politischen Lagerdenken verhaftet war. Für eine aufrechte Linke war es verboten, Thatcher interessant zu finden. Es gab da nur wenige Ausnahmen, die unterschieden zwischen der berechtigten Kritik an Thatchers Politik einerseits und ihrer Funktion als Rollenmodell andererseits. Wir müssen lernen, dass man eine Frau an der Macht bis auf Weiteres bemerkenswert finden kann, auch wenn man ihren Umgang mit der Macht kritisiert.
Spiegel: Gibt es aus Ihrer Sicht eigentlich eine Verpflichtung für Politikerinnen, sich für die Sache der Frauen einzusetzen?
Schwarzer: Überhaupt nicht. Ich hoffe das, aber ich erwarte es nicht.
Spiegel: Angela Merkel wurde ja anfangs kritisiert, weil sie sich als Kanzlerin nicht für Frauenthemen engagiert hat.
Schwarzer: Ich bin die Erste, die das versteht. Für den westdeutschen Mann war es ja schon Zumutung genug, dass eine Ostdeutsche ins Kanzleramt einzog. Und dann auch noch eine Frau! Wenn sie da auch noch angefangen hätte, die Frauenrechtlerin zu geben, dann hätte sie sich gleich eine Bombe unter den Stuhl legen können. Aber sie hat dann ja ihre Familienministerin eine sehr fortschrittliche Frauenpolitik machen lassen.
Spiegel: Viele amerikanische Feministinnen haben es Hillary Clinton übel genommen, dass sie ihrem Mann auch noch die Treue hielt, als herauskam, dass er ein notorischer Fremdgänger ist.
Schwarzer: Es gibt keine Frau, die in den vergangenen Jahrzehnten öffentlich so vorgeführt und gedemütigt worden ist wie Hillary Clinton. Für mich ist es ein Wunder, dass sie nicht schon längst in der Psychiatrie gelandet ist. Als Bill angetreten ist, sagte er: „Wählt mich, und ihr bekommt zwei zum Preis für einen.“ Das war eine stolze Ansage, aber natürlich auch die Einladung für alle Frauenhasser, Hillary ins Visier zu nehmen. Plötzlich war sie die böse Hexe im Weißen Haus. Natürlich hat sie das getroffen. Unter dem Druck der Angriffe machte sie sich klein und wurde scheinbar die First Housewife, die wöchentlich die Frisur wechselte, Cookies buk und ihrem Bill ein schönes Heim bereitete. Es hat ihr alles nichts genutzt. Als die Monica-Lewinsky-Affäre losbrach, hieß es nun auch noch: Na ja, sie mag zwar intelligent sein, und Bill kann sich mit ihr über Politik unterhalten, aber er begehrt sie nicht. Das war perfide und verletzend. Die uralte Teilung von Frauen in Kopf und Körper! Jetzt sehen wir den finalen Kampf: der Supermacho Trump gegen die Feministin Clinton.
Spiegel: Warum werden Frauen, die an die Macht wollen, so stark über Äußerlichkeiten angegriffen?
Schwarzer: Weil unser Wert als Objekt lange entscheidend war. Frauen waren ganz real relative Wesen. Ohne die Gunst eines Mannes waren wir verloren. Diese Vorstellung sitzt immer noch tief. Ich bin überzeugt, dass man bis heute fast jede Karrierefrau kippen kann mit der Aussage: „Du magst zwar tüchtig und intelligent sein, nur leider bist du nicht begehrenswert.“ Inzwischen gibt es die Versuche erfolgreicher Frauen, dem offensiv zu begegnen. Indem sie sich demonstrativ weiblich inszenieren, sie tragen dann High Heels und sehr kurze Röcke. Ich bezweifle allerdings, dass das die richtige Strategie ist.
Spiegel: Was ist die richtige Strategie?
Schwarzer: Den eigenen Stil wahren, seine Wurzeln nicht durch Überanpassung kappen. Merkel trägt einfach praktische Sachen, Blazer, Hosen und flache Schuhe; das mag langweilig sein, aber es passt zu ihrer nüchternen Art. Theresa May wagt eine extravagante Eleganz, dieses Augenzwinkern mit den Tigerpumps finde ich witzig. Ich finde es allerdings traurig, wenn Frauen sich hinter einer rüstungsartigen Kleidung verbergen wie Hillary Clinton. Obwohl: Gerade bei ihr verstehe ich das sehr gut!
Spiegel: Als Sie in den Siebzigerjahren eine bekannte Figur wurden, gab es auch viele unfreundliche Kommentare über Ihr Aussehen. Sie waren die „Nachteule mit dem Sex einer Straßenlaterne“. Wie erträgt man so was?
Schwarzer: Da war ich Anfang dreißig und hatte bis dahin die Erfahrung gemacht, dass die Männer eher zu viel von mir wollten als zu wenig. Jeder Feministin wird grundsätzlich abgesprochen, attraktiv zu sein, egal wie sie aussieht. Ich weiß noch gut, wie im Jahr 1977 im „Stern“ ein Foto von mir erschien. Ich trug ein Leinenkleid von einer Pariser Designerin, die damals sehr angesagt war. Die Bildunterschrift lautete: „Schwarzer in einem Sack“. Das Klischee hält sich bis heute. Ich habe Gott sei Dank ein robustes und fröhliches Gemüt. Aber schauen Sie sich bekannte amerikanische Feministinnen an, Kate Millett oder Shulamith Firestone. Beide waren immer mal wieder in der Psychiatrie. Dahin hatte nicht zuletzt die Hetze ihrer eigenen Mitkämpferinnen sie befördert.
Spiegel: Woher kam der Hass gegen Sie?
Schwarzer: Na ja. Seit dem „Kleinen Unterschied“, der im Jahr 1975 erschien, ging es um Sex und Liebe, die Machtverhältnisse im Bett. Ich habe sozusagen in deutschen Schlafzimmerbetten auf der Ritze gelegen. Viele Frauen lasen in dem Buch zum ersten Mal, was sie bis dahin kaum zu denken gewagt hatten. Das hat so manchen Mann irritiert.
Spiegel: Das Erscheinen des „Kleinen Unterschieds“ fällt ziemlich genau zusammen mit dem Ende Ihrer langjährigen Beziehung zu Bruno, Ihrem französischen Lebensgefährten, und dem Beginn einer Beziehung mit einer Frau. War der „Kleine Unterschied“ auch biografisch gefärbt?
Schwarzer: Sicher. Das war die Zeit der feministischen sexuellen Revolution. Plötzlich fanden Frauen auch Frauen liebenswert.
Spiegel: Warum haben Sie eigentlich nicht schon damals öffentlich gemacht, dass Sie bisexuell sind? Viele lesbische Frauen hätten das als Ermutigung begriffen.
Schwarzer: Das Buch war eine enorme Ermutigung für viele Frauen, egal wie sie lebten: in einer Beziehung mit einem Mann, mit einer Frau oder dazwischen. Doch ich war noch nie der Ansicht, dass es zu meinem feministischen Engagement gehört, privaten Striptease zu machen. Auch die Exempel im „Kleinen Unterschied“ sind ja anonymisiert. Sicher hat auch der Gedanke eine Rolle gespielt, dass ich schon genug Ärger hatte und nicht noch eine Front eröffnen wollte.
Spiegel: Viele Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, legen sich mit der Zeit einen Panzer zu, um die Angriffe aushalten zu können. Das bedeutet aber auch, dass berechtigte Kritik nicht mehr durchdringt.
Schwarzer: Worauf wollen Sie hinaus?
Spiegel: Viele haben nicht verstanden, warum Sie sich für eine Imagekampagne der Bild-Zeitung hergegeben haben.
Schwarzer: Ach Gott, die olle Kamelle von vor fast zehn Jahren. Eine befreundete Werberin hat mich gefragt, ob ich nicht bei einer Kampagne mitmachen will, in der bis dahin nur Männer vorkamen, von Gandhi bis Willy Brandt. Ich dachte: Na ja, wenn das Blatt, das dich bisher so bekämpft hat, sich nun mit dir schmücken will, dann ist das ja auch ganz schön. Ich habe übrigens auch schon mal bei einer Imagekampagne der „FAZ“ mitgemacht. Dabei sehe ich als Feministin und Blattmacherin alle Medien kritisch – den Spiegel allen voran. Trotzdem hätte ich mir das mit Bild vielleicht sparen sollen. Wenn ich die Reaktionen sehe.
Spiegel: Ein noch größerer Fehler war, dass Sie die Zinsen für Ihr Konto in der Schweiz nicht versteuert haben.
Schwarzer: Ja, das war ein echter Fehler!
Spiegel: Als der Spiegel im Februar 2014 die Affäre enthüllte, erklärten Sie, Sie hätten ursprünglich das Geld deswegen gehortet, um einen Notgroschen zu haben, falls die Angriffe in Deutschland gegen Sie zu heftig werden.
Schwarzer: Stimmt. Ich fand es beruhigend, außerhalb von Deutschland Geld zu haben. Aber es war dumm, das öffentlich zu sagen.
Spiegel: Fühlen Sie sich ungerecht behandelt?
Schwarzer: Vom Spiegel auf jeden Fall. Der hat sich ja die Freiheit genommen, in meinem Fall das für alle Bürger geltende Steuergeheimnis zu brechen.
Spiegel: Wir haben da ein berechtigtes öffentliches Interesse gesehen. Sie galten ja als moralische Instanz. Und vielleicht war auch deswegen die öffentliche Enttäuschung so groß.
Schwarzer: Das müssen Sie beurteilen.
Spiegel: Als die Steueraffäre vor mehr als zwei Jahren bekannt wurde, sagten Sie sofort, Sie wollten eine Stiftung für die Rechte von Frauen gründen und sie mit einer Million Euro ausstatten. Jetzt ist herausgekommen: Die Stiftung gibt es immer noch nicht.
Schwarzer: Das Steuerverfahren hat sich über zwei Jahre lang hingezogen, und vor Abschluss konnte ich die Stiftung, die seit Jahren beim Notar liegt, gar nicht gründen. Darf ich jetzt vielleicht einmal einen kleinen Moment lang verschnaufen? Doch seien Sie beruhigt: Die Stiftung kommt irgendwann. Die gehört seit Langem zu meiner Lebensplanung.
Spiegel: Können Sie loslassen?
Schwarzer: Wen?
Spiegel: Die „Emma“ zum Beispiel.
Schwarzer: Ich soll die „Emma“ fallen lassen? Also hören Sie! Ich bin nur wenige Jahre älter als Hillary Clinton, die Präsidentin werden will. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich dringend in den Ruhestand treten muss. Ich glaube außerdem, meine Kolleginnen würden verzweifeln, wenn ich sagen würde: Macht den Laden alleine.
Spiegel: Ihre Argumentation kennt man von anderen Patriarchen, die furchtbar gerne aufhören würden, aber leider keinen geeigneten Nachfolger finden.
Schwarzer: Nennen Sie mal eine Nachfolgerin!
Spiegel: Wir halten fest: Sie sind unersetzlich.
Schwarzer: Ich habe einfach Freude an meiner Arbeit, die sehr sinnvoll ist. Sinnvoller denn je.
Spiegel: Ihre Biografin Bascha Mika hat geschrieben, im System Schwarzer geht es um Machterhalt. Empfinden Sie das als Kompliment?
Schwarzer: Nun, dieses 18 Jahre alte Buch ist weniger Biografie und mehr Projektion. Interessiert mich Macht? In der Kategorie habe ich noch nie gedacht.
Spiegel: Frau Schwarzer, bitte, das ist jetzt eine ganz öde Politikerantwort.
Schwarzer: Ist aber so. Was mich interessiert, ist Unabhängigkeit. Und die Möglichkeit zu handeln, die Verhältnisse zu verbessern.
Spiegel: In Ihrer Autobiografie schreiben Sie, dass Sie nach der Gründung der EMMA oft in Schwulendiscos gegangen sind, weil Sie Frauen nicht mehr ertragen konnten.
Schwarzer: Stimmt. Das war sehr erholsam mit den Jungs an der Theke.
Spiegel: Was hat Sie mehr getroffen: die Angriffe der Männer oder der Frauen?
Schwarzer: Die der Frauen natürlich! Bis heute. Bei Männern kann man die Sache ja immer rationalisieren, so nach dem Motto: Du stellst deren Privilegien infrage, da ist es doch klar, dass das Patriarchat zurückschlägt.
Spiegel: Was wurde Ihnen vonseiten der Frauen vorgeworfen?
Schwarzer: Zu stark. Zu dominant. Zu selten geweint. Hinzu kamen die politischen Differenzen. Ich stand immer für einen antibiologistischen Feminismus, der die Machtfrage stellt. Ich konnte nie etwas anfangen mit Frauen, die sich auf ihre sogenannte Weiblichkeit beriefen, den Mutterkult pflegten und darauf ihr Selbstbewusstsein bauten. Gleichzeitig wurde ich von linken Frauen bekämpft, für die der Feminismus nur ein Unterpunkt des Klassenwiderspruchs war. Wenn Sie so wollen, wiederholt sich jetzt gerade diese Geschichte wieder.
Spiegel: Wie meinen Sie das?
Schwarzer: Manche sogenannte Netzfeministinnen haben panische Angst vor dem Vorwurf, Rassistinnen zu sein, und gehen so weit, die Burka zu rechtfertigen, dieses Leichentuch für Frauen. Dabei ist der Kampf gegen den religiösen Fundamentalismus, allen voran gegen den politisierten Islam, schon lange existenziell. Nicht nur für Frauen.
Spiegel: Der Feminismus wollte auch immer überkommene Männerbilder irritieren. Das ist gelungen, mit positiven, aber auch negativen Auswirkungen. Kann es sein, dass die vielen Attentäter in diesen Tagen in ihrer Männlichkeit gekränkt gewesen sind?
Schwarzer: Ohne jeden Zweifel. Wir leben in Zeiten des Umbruchs, solche Zeiten sind immer die gefährlichsten. Der Kern der Konstruktion von Männlichkeit ist ja die Gewalt. Und die Amokläufer und Attentäter greifen auf diesen Kern zurück. Aber verunsichert und gedemütigt fühlen diese rasenden Männer sich nicht nur durch die erstarkenden Frauen. Im Westen spielt auch die Deindustrialisierung und Globalisierung eine Rolle, die die Männer arbeitslos macht. Und im Nahen Osten sind es die Kriege, die der Westen angefangen hat, die die Männer brutalisieren.
Spiegel: Wie soll man Ihrer Meinung nach hierzulande mit den gekränkten Männern umgehen?
Schwarzer: Wir dürfen nicht nur aufrüsten, sondern müssen auch „die Seelen retten“, wie der algerische Schriftsteller Kamel Daoud es formuliert. Das heißt, wir müssen erhebliche Mittel zur Verfügung stellen, um früh herauszufinden, wo einer unrettbar gefährlich ist, vor dem müssen wir uns dann schützen. Und wir müssen ebenfalls herausfinden, wo die vielen anderen sind – die frustrierten, traumatisierten, sich gedemütigt fühlenden Männer, die wir noch auf andere Gedanken bringen können. Und denen müssen wir reale Chancen bieten.
Spiegel: Sie sagen, der Kern der Konstruktion von Männlichkeit sei die Gewalt, aber es gibt inzwischen ganz andere Männlichkeitsbilder. Den Vater in Elternzeit zum Beispiel.
Schwarzer: Ja, bei uns, wo die Welt noch in Ordnung scheint. Und das ist gut so. Und da sind jetzt auch die Frauen gefragt. Sie müssen stärker honorieren, wenn Männer versuchen, anständige Menschen zu sein. Es gibt sie ja leider, die traditionell tiefsitzende weibliche Faszination für den dunklen Verführer. Die sollten sich die Frauen verdammt noch mal abgewöhnen!
Spiegel: Die britische Premierministerin May hat kein Kind, Merkel hat keins …
Schwarzer: … Alice Schwarzer auch nicht.
Spiegel: Ist das der Preis der Macht?
Schwarzer: Es würde EMMA nicht geben, wenn ich ein Kind hätte. Es wäre zeitlich gar nicht gegangen. Es gab ja Phasen, in denen ich in der Redaktion übernachtet habe. Und wenn ich mir das Leben der Kanzlerin angucke, du lieber Gott. Aber was heißt denn überhaupt Preis der Macht? Ich denke, es gibt einfach Frauen, die gar nicht unbedingt Mutter werden wollen. So wie manche Männer keine Väter werden wollen.
Spiegel: War es in den Siebzigerjahren auch eine politische Entscheidung, keine Kinder zu kriegen? Ein Symbol, sich nicht an das patriarchale System zu binden?
Schwarzer: Nein. Ich glaube nicht, dass Menschen so funktionieren. Man trifft solche Entscheidungen nicht rein vom Kopf her, das hat viel mit Emotionen zu tun. Wir Feministinnen waren ja nicht die maoistische Bewegung, bei uns ging es nicht so rigide zu. Aber natürlich hat uns der Feminismus die Augen geöffnet. Wir begriffen, dass die Männer und der Staat uns mit den Kindern allein lassen. Und bis heute bedrückt es mich, dass den Frauen nicht die Wahrheit gesagt wird über die Mutterschaft. Sie werden ja ungeheuer belogen.
Spiegel: Belogen?
Schwarzer: Ja, es wird ihnen vorgegaukelt: Ihr könnt alles schaffen! Mutterschaft und Karriere – kein Problem. Aber das ist ja nicht wahr. Selbst wenn eine Frau das Glück hat, einen echten Partner zu haben, mit dem sie sich die Arbeit zu Hause teilt. Auch der kann ja unters Auto kommen. Und dann? Letztlich muss jede Frau bis zum Ende durchspielen, was es für sie bedeutet, ein Kind zu haben, und ob sie es auch allein schaffen würde. Und ich muss hier doch auch mal etwas Kritisches über Frauen sagen: Viele nehmen die Väter nicht genug in die Pflicht. Als Bruno und ich darüber nachgedacht haben, ein Kind zu bekommen, habe ich ihm gleich gesagt: Aber im Kreißsaal bist du dabei! Ich hatte keine Lust, da allein vor mich hinzuschreien.
Spiegel: Warum nehmen die Frauen ihre Männer nicht stärker in die Pflicht?
Schwarzer: Weil Frauen Angst haben vor Liebesverlust. Das ist das Scheißproblem von Frauen. Dass sie immer und um jeden Preis geliebt werden wollen. Das macht sie unfrei und opportunistisch.
Spiegel: Kurz bevor Theresa May Premierministerin wurde, musste sie sich von einer Konkurrentin anhören, dass sie ja keine Mutter sei und sich diese Tatsache politisch auswirken könnte. Angela Merkel ging es vor elf Jahren im Wahlkampf ähnlich. Warum ist dieses unfaire Argument so haltbar?
Schwarzer: Vielleicht ist es das gar nicht mehr. Bei May hat sich dieser Vorwurf ja Gott sei Dank als Bumerang erwiesen.
Spiegel: May hat öffentlich bedauert, keine Kinder zu haben. Das hört man selten von Frauen. Ist das Bedauern von Kinderlosigkeit ein Tabu?
Schwarzer: Wenn das so ist, wäre das traurig. Aber dann müssten es die Frauen, die so empfinden, zum Thema machen.
Spiegel: Verspüren Sie manchmal eine Wehmut, dass Sie auf Kinder verzichtet haben?
Schwarzer: Nein. Ich habe ja ein ziemlich aufregendes und sehr erfülltes Leben.
Spiegel: Als Sie 20 Jahre alt waren, gingen Sie als Au-pair-Mädchen nach Paris. So einen Job sucht man sich doch nur, wenn man besondere Freude an Kindern hat.
Schwarzer: Ja, das habe ich auch. Mit den Jungen von damals bin ich bis heute befreundet. Der eine hat seine Tochter Alice genannt. Auch ohne eigene Kinder habe ich ständig mit Kindern zu tun. Ich habe seit über dreißig Jahren ein Haus auf dem Land. Und wenn ich da ankomme, fliegt schon die Türe auf, und die Nachbarskinder stürmen rein.
Spiegel: Also doch ein kleines Bedauern?
Schwarzer: Es ist aufschlussreich, dass selbst Sie mich so auf mein Frausein festlegen. Einem Mann würden Sie diese Fragen nicht stellen. Aber gut, wenn es Ihnen Spaß macht: Manchmal denke ich, Großmutter sein wäre eigentlich ganz nett. Die Kinder kommen dann und wann zu Besuch, sind goldig, und man ist gelassen. Das finde ich einen Bombenposten.
Spiegel: Frau Schwarzer, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.
Das Gespräch führten Susanne Beyer und René Pfister und ist im Spiegel 31/16 erschienen.