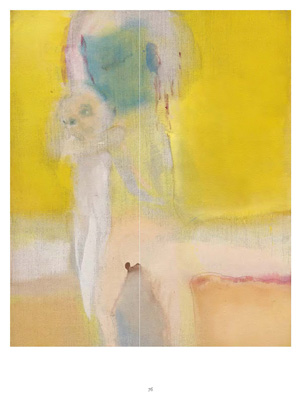Alice und die Homosexualität
L-MAG: Emma war eine der ersten Zeitschriften, die auch über Lesben geschrieben hat. Ihr hattet schon früh küssende Frauen auf dem Cover. Warum war das für euch ein Thema?
Alice Schwarzer: Ich bin die Autorin vom „Kleinen Unterschied“! Ich weiß nicht, wie viele Frauen sich durch das Buch auch mal in eine Frau verliebt haben. Auf jeden Fall viele. Das Thema vom „kleinen Unterschied“ war ja die Funktion des Sexmonopols von Männern über Frauen, also die „Zwangsheterosexualität“ (ein Begriff des Analytikers Ferenczi) und die Selbstverständlichkeit der Homosexualität. Sexualität ist also früh ein zentrales Thema von mir gewesen. Also auch immer in EMMA präsent. Als wir starteten, gab es zwar alternative Lesbenblätter innerhalb der Frauenbewegung, aber es gab keine Öffentlichkeit für das Thema. Wir hatten in den frühen Jahren darum den Ruf, ein Lesbenblatt zu sein, auch wenn wir das nie waren. EMMA war und ist ganz einfach eine feministische Zeitschrift für alle.
Liest du eigentlich L-MAG?
Klar! Die liegt bei uns in der Redaktion. Wir verfolgen euch aufmerksam.
Ihr habt auch schon sehr früh Transsexualität als Themen aufgegriffen. Wie kamt ihr damals darauf?
In den 70ern war Transsexualität kein Thema. Aber ich wollte nach dem „Kleinen Unterschied“ ein Buch darüber schreiben. Ich hatte ja in Paris an der Fakultät Vincennes studiert, unter anderem bei Foucault, und kannte die amerikanische Avantgarde der Sexualforscher sehr gut, wie John Money und Robert Stoller. Übrigens war es Stoller, der in den 1960er Jahren den Begriff „Sex and Gender“ geprägt hatte, nicht Butler. Bei der Transsexualität fand ich spannend, dass die Seele stärker sein kann als der Körper. Ich habe das Buch dann doch nicht geschrieben, weil ich dann EMMA gegründet habe. Anfang der 80er kamen transsexuelle Männer-zu-Frauen in die Frauenzentren und viele in der Bewegung waren dagegen. Ich fand das falsch. Also habe ich 1984 einen „Brief an eine Schwester“ geschrieben, pro Transsexuelle. Der ging an eine Feministin, die vehement gegen transsexuelle Männer-zu-Frauen in Frauenzentren argumentierte. Seither ist Transsexualität und das Gespräch mit Transsexuellen auch in EMMA ein sehr präsentes Thema.
Wie stehst du heute dazu?
Ich habe schon immer die Auffassung vertreten, dass Menschen unterstützt werden müssen, die in einen so dramatischen Identitäts-Konflikt geraten. Gleichzeitig war und bin ich gegen zu rasches Operieren, weil das irreversibel ist. Und als Feministin frage ich mich natürlich grundsätzlich: Wieso muss ich den Körper wechseln, um zu sein, was ich will? Es ist doch die gnadenlose Rollenzuweisung und eine lange Prägung, die aus Menschen Frauen und Männer macht. Es gibt Männer oder Frauen, die sich in der zugewiesenen Rolle nicht wohlfühlen und das kann sich so sehr steigern, dass sie lieber Frauen bzw. Männer sein wollen. Die wahre Lösung allerdings wäre: Wir sind alle Menschen – manchmal mehr „männlich“ und manchmal mehr „weiblich“. Ich weiß, das ist reine Theorie im Jahr 2019 – aber es ist das Ziel. Darum bin ich beunruhigt darüber, dass dieses Thema heute beredet wird, als sei es eine leichte und coole Sache, das Geschlecht zu wechseln. Aber ich verstehe natürlich gut, warum immer mehr Frauen lieber Männer sein wollen.
Warum?
Weil die Frauenrolle noch einengender ist als die Männerrolle. Ich weiß ja selber, was es heißt, eine Frau zu sein. Ich verstehe also, dass manche sich sagt: Ich werde lieber ein Mann und dann bin ich dieses ganze Theater los. Aber es ist keine Lösung. Es ist nur der Wechsel von einer Rolle in die andere.
Was sagst du zu Radikalfeministinnen, die finden, Transfrauen – also männlich Geborene und jetzt weiblich Lebende – haben in Frauenräumen nichts zu suchen?
Ich sehe diesen Ausschluss kritisch, das habe ich ja schon 1984 geschrieben. Aber ich finde es gleichzeitig problematisch, dass von vielen ihr bisheriges Leben einfach geleugnet wird. Das beschreibt beispielsweise auch Susan Faludi in ihrem Buch „Die Perlenohrringe meines Vaters“ (im Original: „In the Darkroom“). Ihr Vater ist im hohen Alter eine Frau geworden, und sie spürt dem Warum nach. Transsexuelle Frauen haben Jahrzehnte als Mann gelebt. Ich rede nicht von Biologie und nicht vom subjektiven Empfinden; ich rede von Prägung und Realität. Ein transsexueller Mensch, ob er will oder nicht, hat am Ende seiner Strecke also beide Erfahrungen. Das ist eigentlich total spannend und muss nicht geleugnet werden. Der renommierte Neurobiologe Ben Barres zum Beispiel hat 2007 in EMMA sehr beeindruckend beschrieben, wie respektvoll er jetzt als Mann behandelt wird – und wie herabwürdigend davor als Frau.
Zurück zu dir. Hattest du einen Schlüsselmoment, als du entschieden hast, Feministin zu sein?
Schlüsselerlebnis? Nein. Ich bin in der Nachkriegszeit bei meinen Großeltern aufgewachsen. Mein Großvater war meine soziale Mutter, er hat mich gewickelt und ernährt, und meine Großmutter war eine politisch und intellektuell sehr interessante Persönlichkeit. Bei uns gab es also eine leichte Rollenverkehrung. Mir hatte niemand gesagt, dass eine Frau „nur“ eine Frau ist. Ich war frei, bin auf dem Land und am Waldrand aufgewachsen, bin die Bäume hochgeklettert. Ehrlich gesagt, habe ich mich mit Mädchen oft gelangweilt. Puppen und so. Ich habe lieber mit den Jungs gespielt, im Wald und am Bach. Aber ich war kein Garçon manqué. Nur ein freies, unangepasstes Mädchen, dem man vergessen hatte zu sagen, dass es „nur eine Frau“ ist. Doch als in der Tanzschule die Jungs die Mädchen auffordern sollten, habe ich es begriffen... Später haben selbst die netten Männer Dinge gesagt, wie „Alice, eine Frau macht nicht so große Schritte“ oder „Eine Frau lacht nicht so laut“. Ich machte dann extra große Schritte und lachte noch lauter. In den 60ern habe ich Simone de Beauvoir und Betty Friedan gelesen. Und als dann in Paris eine Gruppe Frauen am 26. August 1970 einen Kranz unter dem Arc de Triomphe „für die unbekannte Frau des unbekannten Soldaten“ niederlegte, wusste ich: Das sind meine Mädels!
1975 wurdest du durch das TV-Streitgespräch mit der Antifeminstin Esther Vilar medial berühmt. 2001 gab es die Sendung bei Johannes B Kerner mit Verona Pooth. Vor wem hast du in politischen Diskussionen mehr Angst – Männer oder Frauen?
Ich habe nie Angst. Auch wenn das nicht immer richtig ist. Ich sollte vielleicht ab und zu mal Angst haben. Was mich bedrückt, sind natürlich die Frauen. Feindliche Männer kann ich verstehen, sie verteidigen ihre Privilegien. Aber feindliche Frauen sind tragisch. Sie durchschauen meist nicht, dass es ein Klassiker des Patriarchats ist, uns aufeinander zu hetzen. Deswegen habe ich mich nur sehr selten öffentlich mit Frauen gestritten. Ich halte das für destruktiv.
Kommen wir zu den lesbischen Themen. Obwohl du schon Mitte der 70er Jahren Beziehungen zu Frauen hattest, hast du erst mit deiner Autobiografie „Lebenslauf“ 2011 Stellung dazu genommen. Warum?
Ich konnte ja schwer sagen: Ich bin lesbisch. Das entspricht nicht meiner Lebensrealität. Als ich Mitte der 70er nach Berlin kam, hatte ich zuvor eine 10-jährige Beziehung mit einem Mann. Mit ihm war ich bis zu seinem Tod eng befreundet, er war kein Umweg oder Irrtum. Ich nutze die Gelegenheit, in L-Mag zu gestehen: Ich habe erst durch die Frauenbewegung entdeckt, dass man auch Frauen lieben kann. Das spiegelt sich eigentlich auch alles im „Kleinen Unterschied“. In meiner Arbeit hat sich immer mein Denken und Leben gespiegelt. Aber privat gab es für mich keinen Anlass zu Bekenntnissen. Ich habe als sehr öffentlicher Mensch ein starkes Bedürfnis nach Privatheit und Diskretion. Bis zum „Lebenslauf“ hatte ich ja auch nicht über meinen Lebensgefährten geredet, meinen Platz dazwischen. Ich tauge also nicht als Frontfrau für Lesben. Eher als Frontfrau für heterosexuell lebende Frauen, die die Frauen entdecken.
Definierst du dich als Lesbe?
Nein! Das wäre Hochstapelei. Ich stehe jedoch uneingeschränkt dazu, dass ich seit über 30 Jahren mit meiner Lebensgefährtin zusammen bin. Daraus habe ich in meinem persönlichen Umfeld auch noch nie ein Geheimnis gemacht.
Du hast eine Menge abbekommen. Wie hältst du das aus?
Ich bin das gewohnt. Ich hatte eine sehr randständige Kindheit. Ich bin als uneheliches Kind bei meinen bürgerlichen, aber verarmten Großeltern aufgewachsen und komme aus einer hoch politischen Anti-Nazi-Familie. Das war auch nach 1945 nicht so angesagt. Bei meinen Prägungen hatte ich keine Wahl: In meiner Familie hat man bei Unrecht einfach nicht weggeschaut. Ich war es also schon immer gewohnt, Positionen zu beziehen, die nicht Mainstream sind. Und wird sich nie ändern. Ich bin ja auch Journalistin geworden, um die Welt ein Stück zu verbessern. (lacht) Klar, ich bin links einzuordnen, aber war nie in einer Partei oder einer Organisation. Als dann die Frauen aufbrachen, war das meine Sache. Da konnte ich nicht länger nur beobachtende Journalistin bleiben, sondern musste selber aktiv werden.
Vertraust du Menschen noch?
Ja. Komisch, nicht? Eigentlich sollte ich das nicht, aber ich bin hoffnungslos positiv. Ich habe die Gabe, Negatives zu vergessen und mir Positives zu merken. Allerdings habe ich schon eine kleine Liste, vielleicht ein halbes Dutzend Namen, die ich nie vergessen werde.
Wie ist die Frauenquote auf dieser Liste?
Es sind mehr Frauen als Männer.
Du hast gesagt, du hast dich früher links verortet. Wo stehst du heute?
In keinem Politlager. Ich bin einfach für eine Welt mit sozialer Gerechtigkeit und Chancengleichheit für alle, ohne Machtmissbrauch. Für universelle Menschenrechte. Wir Feministinnen wussten schon immer, wie relativ diese Labels sind. Die männliche Linke war auch nie frauenbewusster als die Rechte. Wir gehören in keine Partei.
Dein letztes Buch ist „Meine algerische Familie“. Ich habe den Eindruck du hast ein sehr zwiespältiges Verhältnis zum Land und der Familie. Einerseits bist du ihnen sehr verbunden, andererseits triffst du als Feministin auf einige Machos in der Familie.
Klar, die gibt es überall.
Wie hältst du das aus?
Die Frage stellt sich nicht, wie ich das aushalte. Es ist die Realität. Das nehme ich zur Kenntnis. Ich habe ja auch noch nie versucht, neue Normen aufzustellen, sondern nur die bestehenden infrage gestellt. Mich interessiert Aufklärung, Information und Bestärkung zum Widerstand. Was die einzelne Frau daraus macht, ist eine Frage des jeweiligen Individuums und des Kontextes, der Möglichkeiten. Ich bin allerdings keine Kulturrelativistin, für mich sind die Menschenrechte unteilbar und gelten für alle. Aber wenn ich in einem fremden Land bin, muss ich erstmal berücksichtigen, wie es dort läuft. Ich kann nicht hingehen und sagen: Hey, ihr seid ja gar nicht emanzipiert!
Islamismus ist eines deiner großen Themen.
Ja, seit der Iranischen Revolution 1979. Mich haben damals französische Freundinnen angerufen und gefragt, ob ich mit in den Iran komme, weil sie einen Hilferuf von Frauen aus dem Land erhalten hatten. Da habe ich verstanden, dass der politisierte Islam eine rechte Ideologie ist. Nicht der Islam, der Islamismus.
Viele machen dir auf Grund dieser Diskussion den Vorwurf des Rassismus. Was antwortest du?
Ich finde es schlicht grotesk. Und zynisch. Wie wäre es mit einem Blick auf die Realität? Wie kann man sich als Feministin bezeichnen und gleichzeitig mit dem politischen Islam sympathisieren? Viele meiner Freunde und Freundinnen sind aufgeklärte, demokratische Muslime und Musliminnen und fragen mich: Wie kann es sein, dass Linke und Feministinnen im Westen mit diesen Scharia-Muslimen, diesen Rechten sympathisieren? Ich antworte also auf den Rassismusvorwurf: Ihr seid rassistisch! Weil solidarisch mit Rechten.
Dein Buch zu Köln und auch der online Text zu Chemnitz spielt dennoch Rechten hierzulande in die Hände. Ist das ein Nebeneffekt?
Das von mir herausgegebene Buch zu Silvester in Köln hat auch heute, zwei Jahre danach, uneingeschränkt Gültigkeit. Es ist eine sehr genaue Publikation zu diesem Ereignis. Köln war kein Versehen, das war eine politische Provokation. Von acht Autoren und Autorinnen meines Buches haben übrigens vier einen muslimischen Hintergrund – Frauen und Männer. Alle vier haben die gleiche Analyse wie ich. Da ist es doppelt unglaublich, dass manche sogenannte antirassistische Linke oder Feministinnen behaupten, das sei rassistisch. Mit dieser Haltung lassen sie alle Opfer der islamischen Fundamentalisten im Stich, auch die muslimischen. Ich solidarisiere mich mit Opfern und nicht mit Tätern.
Was ist also dein aktueller Standpunkt zum Kopftuch?
Immer der Selbe. Seit 1979 ist das Kopftuch die Flagge des politischen Islam. Dieser Islamismus hat inzwischen international Universitäten und das ganze Bildungswesen unterwandert. Mit fatalen Folgen. Ich unterscheide allerdings beim Kopftuch zwei Ebenen: Zum einen die subjektive. Da gibt es vielfältige Gründe für Frauen, ein Kopftuch zu tragen. Mit diesen Frauen kann man diskutieren. Es ist ihre Entscheidung, das Kopftuch zu tragen. Gleichzeitig gibt es eine objektive Bedeutung des Kopftuchs und die ist hochpolitisch. Es ist kein religiöses Zeichen, sondern ein politisches. Eine Studie des Innenministeriums besagt: Drei von vier Musliminnen in Deutschland haben noch nie ein Kopftuch getragen – und sogar jede zweite, die sich selber als „tief religiös“ bezeichnet, trägt kein Kopftuch. Die Kopftuch-Muslimin ist also vor allem ein Medien-Produkt. Ich spreche auch nicht vom Islam als Glauben. Ich rede ausschließlich über den politisierten Islam, also über den Missbrauch des Islam für eine politische Strategie. Den Trend gibt es übrigens auch beim Christentum. 80 Prozent der Evangelikalen zum Beispiel haben Trump gewählt.
Apropos Trump, entmutigt es dich, dass nach 50 Jahren feministischen Kampf jetzt so ein Sexist an die Macht gekommen ist?
Nein! Wir haben mindestens 4.000 Jahre Patriarchat hinter uns und gerade mal 50 Jahre Rebellion dagegen – das ist ein Wimpernschlag in der Geschichte. Ich finde, in den letzten 50 Jahren haben wir wahnsinnig viel erreicht. Natürlich gibt es Rückschläge, die Privilegierten lassen sich nicht so einfach ihre Privilegien wegnehmen. Wirklich schlimm ist, dass die größte Aufweichung des Feminismus von Innen kommt. Schon Mitte der 70er Jahre wurde von selbsterklärten Feministinnen eine sogenannte „neue“ Weiblichkeit und die „neue“ Mütterlichkeit propagiert. Das war die alte. Ich stehe für einen Feminismus mit einer langen Tradition, vor und mit uns waren Frauen wie Christine de Pizan oder Simone de Beauvoir, Kate Millett oder Susan Faludi. Wir alle stehen für einen universalistischen Feminismus, für Gleichheit der Geschlechter und Menschenrechte für alle. Es gibt aber natürlich auch andere Varianten des Feminismus. Der Feminismus ist ja keine geschützte Marke.
Das Gespräch führte Dana Müller, es erschien zuerst in L-Mag.