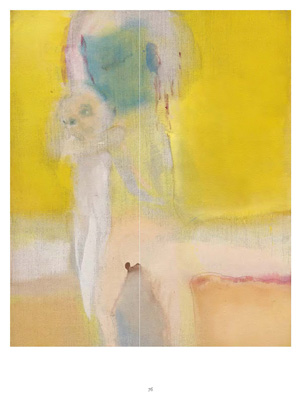Abschied von Alfred Biolek
Anfang der Achtzigerjahre, unsere erste Begegnung im Kölner Treff. Ein Studio mit Publikum und auf der Bühne Alfred Biolek, der als Talkmaster eine bunte Reihe von Gästen befragt. Sodann bin ich dran. Und es ist schnell klar: Wir lachen beide gerne. Nach mir kommt der CDU-Minister Norbert Blüm, der drei Meter entfernt neben seiner Frau Marita in der ersten Reihe sitzt. Ich teile munter gegen Blüm aus, der gerade ein Buch über »die sanfte Macht der Familie« veröffentlicht hat – und seine Frau Marita lacht laut und herzhaft. So war das damals: Man konnte sich fetzen, aber trotzdem sympathisch finden.
Alfred und ich haben uns nie gefetzt. Es gab keinen Anlass. Wenige Tage nach der Talkshow lud er mich ein zu seinem Lieblingsitaliener, Alfredo. Der erklärte mir bei der Gelegenheit, "wie du am besten Dorade machst, Alice. Nur Salz, Pfeffer und Petersilie, mit Olivenöl einreiben, in Silberfolie verschließen und bei 180 Grad im Backofen garen." Köln eben.
Alfred, der große Entertainer,
war in Wahrheit schüchtern
Für Alfred und mich war dieser Abend der Beginn einer langen Freundschaft. Feste, Reisen, aber auch stille Sommerabende zu zweit unter meiner Linde, wo es langsam dunkel wurde und wir – eingehüllt in Schweizer Wolldecken, Alfred war sehr verfroren – bis in die Nacht redeten. Und nicht vergaßen, aus den von Alfred mitgebrachten Flaschen nachzugießen.
Alfred, der große Entertainer, Menschenbefrager und Extrovertierte, war in Wahrheit schüchtern. »Ich bin sehr scheu«, hat er in dem Interview, das ich 1994 für Brigitte, ja, Brigitte, mit ihm geführt habe, gesagt. Und noch einen bemerkenswerten Satz hat er gesagt: »Alle großen Leistungen entstehen immer aus irgendeinem Schmerz.«
Seine Leistungen kennen wir, aber was war sein Schmerz? Der erste war die Vertreibung aus seinem Paradies im Alter von elf Jahren. Das war Freistadt, heute Karviná, in dem Dreiländereck im Osten. Dort ist Alfred 1934 als Tscheche zur Welt gekommen. Sein Vater hatte fünf Nationalitäten, ohne jemals den Ort gewechselt zu haben. Angefangen hatte es mit der österreichischen in der k. u. k. Monarchie. Auch das ist wohl ein Schlüssel zum Kosmopolitischen von Alfred Biolek. Für die deutschsprachige Elite war es ein komfortables Leben: Haus, Garten, Personal, sonntags mit der Kutsche in die Kirche. Der Bruch war brutal. Nach dem Einmarsch der Russen kommt der Vater anderthalb Jahre ins Gefängnis. »Er war kein Nazi, aber ein Mitläufer«, sagte Alfred rückblickend in dem sehr guten Porträt von Sandra Maischberger. Mitglied der Sudetendeutschen Partei und stellvertretender Bürgermeister. Die Mutter und ihr jüngster Sohn Alfred kommen ins Lager und werden nach acht Monaten im Viehwaggon abgeschoben, Richtung Deutschland. Im schwäbischen Waiblingen findet sich die Familie wieder.
Seine Leistungen kennen wir,
aber was war sein Schmerz?
Der zweite Schmerz. Ab wann wird dem Jungen aus dem konservativen, katholischen Elternhaus klar, dass er Männer liebt? Geahnt haben wird er es früh, aber sich auch selbst wirklich eingestanden erst spät. Der studierte Jurist ist 27, als er im Gerichtsflur in München das Schild mit der Ankündigung eines Prozesses wegen Verstoß gegen den Paragrafen 175 sieht. Der bestrafte in Deutschland homosexuelle Männer mit Gefängnis.
Doch genug vom Schmerz. Das Vergnügen, die Bühne, der Auftritt, den Alfred Biolek ab Ende der Siebzigerjahre so virtuos und mit einer für Deutschland untypischen Mischung von Esprit und Leichtigkeit beherrschte, kam von der Mutter. »Auftrag der Mutter« heißt das in der Psychologie. Sie war Schauspielerin, bis der Vater sie mit 17 von der Bühne wegheiratete. Schön, dass sie den Erfolg ihres Sohnes noch voll mitbekommen hat.
Aber Alfred konnte auch streng sein. Ich sehe ihn noch heute vor mir, wie er in der Arena in Luxor mitten im son et lumière-Spektakel, richtig erbost über den »Kitsch«, das Szenario verließ, voll durch die Scheinwerfer schreitend, die sein so markantes Profil überlebensgroß auf die Leinwand warfen.
Von seiner Mutter hatte Alfred auch das Rezept der federleichten Serviettenknödel, die wir Freunde so oft bei ihm genossen haben. Aber eigentlich konnte der Fernsehkoch, ehrlich gesagt, nicht wirklich kochen. Das heißt: Er kochte nur nach Rezept. Improvisieren war in dem Bereich nicht seine Sache.
Unvergesslich unser Besuch auf dem Markt von Killarney, wo wir beide für Freunde in Irland einkauften. Alfred hatte sich von seiner Redaktion in Köln sein aktuelles Lieblingsrezept, etwas mit Shiitake-Pilzen, faxen lassen. Shiitake-Pilze in Killarney. Er hat sie tatsächlich aufgestöbert. Ich aber hatte nur zufällig die Berge von frischen und unglaublich preiswerten Langusten gesehen und zugeschlagen. Zu der Vorspeise gab es dann selbst gerührte Mayonnaise. Alfred musste schmunzeln, dass ich so einfach punktete – wo doch sein Gericht so kompliziert war.
Selten haben wir zwei so gelacht
wie nach seiner Kochshow
Ja, die Mayonnaise. Selten haben wir zwei so gelacht wie nach seiner Kochshow, in der ich 1995 zu Gast war. Gelacht über das Zitronenhühnchen, das unter dem Scharfblick der Kameras und meinem geweiteten Blick auf Höchststufe verbrannte, weil man den TV-Ofen nicht regulieren konnte. Gelacht über die Mayonnaise zur Vorspeise, von »meiner Freundin Alice, der Feministin, die aber fantastisch kochen kann«. Der fantastischen Köchin gerann vor laufender Kamera die Mayonnaise unter den heißen Scheinwerfern live – und ich wurde jahrelang von gutmeinenden Menschen mit heißen Tipps verfolgt (»Einen Esslöffel kaltes Wasser in die Mayonnaise, Frau Schwarzer«).
Eine Woche vor seinem Tod habe ich mich von Alfred verabschiedet. Wir wussten beide: Es ist das letzte Mal. Er war voll präsent, fast heiter. Ich saß am Rand seines Bettes, und wir erinnerten uns. Und da fielen ihm als Erstes wieder die Abende unter der Linde ein.
Als ich mich im Gehen noch einmal umdrehte, hob Alfred leicht die Hand und winkte mir mit einer kleinen Geste nach. Da war es wieder: sein Lächeln.
ALICE SCHWARZER